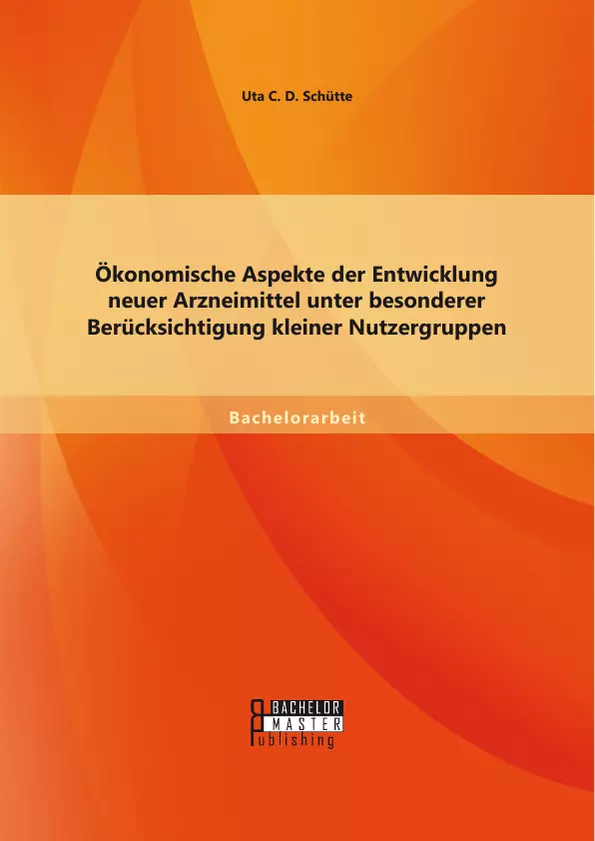Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos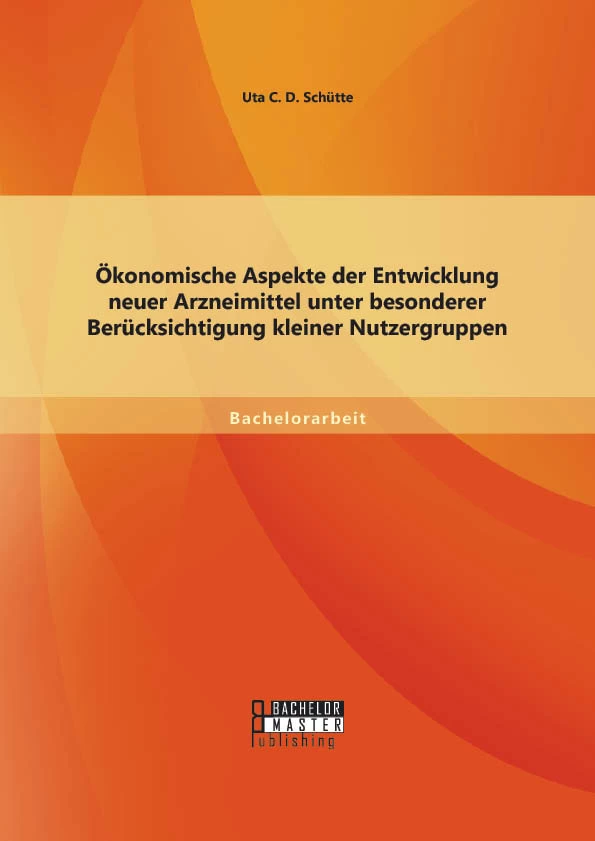
Ökonomische Aspekte der Entwicklung neuer Arzneimittel unter besonderer Berücksichtigung kleiner Nutzergruppen
Bachelorarbeit, 2010, 61 Seiten
Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Note
1
Leseprobe
2. Der Arzneimittelmarkt
Der Arzneimittelmarkt ist ein besonderer Markt, da er aus verschiedenen Gründen nicht ohne staatliche Regulierungen auskommt. Die individuelle Wertschätzung von Gesundheit ist sehr unterschiedlich, woraus sich auch unterschiedliche Zahlungsbereitschaften der Versicherten bei den Gesetzlichen Krankenkassen ergeben. Das wirft das Problem des Moral Hazard auf, welches typisch ist im Versicherungswesen. Je nach dem Grad der Versicherung haben Versicherte mehr oder weniger Anreize zu einer vorbeugenden Lebensweise und zu einem rationalen Gebrauch von Arzneimitteln. Die Informationsasymmetrie zwischen Nachfragern (Patienten und verschreibende Ärzte) und Anbietern von Gesundheitsgütern und die nicht vorhandenen Möglichkeiten das Verhalten der Versicherten zu überprüfen, führen also zu einem irrationalen Umgang mit den knappen Ressourcen (Varian 2007). Auch die theoretische Charakterisierung von Gesundheit als ein öffentliches Gut ist problematisch. Ein Kriterium für öffentliche Güter ist die Nichtrivalität im Konsum, was bedeutet, dass Individuen sich nicht beim konsumieren eines Gutes beeinträchtigen (Bsp. Atemluft). Das zweite Kriterium ist die Nicht-Ausschließbarkeit von Individuen im Konsum von Gütern. Wenn man das Gut „Gesundheit“ nun praktisch betrachtet, wird schnell deutlich, dass es nicht als öffentliches Gut gewertet werden kann. So besteht beispielsweise Rivalität beim Konsum von Gesundheitsleistungen (Krankenhausbetten, Arztbesuche). Diese Probleme begründen die vielfachen staatlichen Eingriffe auf dem Arzneimittelmarkt (Fricke 2008). In welcher Form der Staat eingreift wird auf den nachfolgenden Seiten erläutert.
2.1. Entwicklung neuer Arzneimittel
Die Entwicklung neuer Arzneimittel ist ein sehr wünschenswerter Forschungszweig, da Medikamente zur Heilung oder Verhinderung von Krankheiten dienen, ohne dass Organe entfernt oder verstümmelt werden müssen. Dadurch können große Kosten- und Zeiteinsparungen sowohl für das Gesundheitswesen als auch für Patienten realisiert werden, weil beispielsweise Krankenhausaufenthalte verhindert werden können (Breyer et al. 2003).
Nach negativen Erfahrungen sind in den letzten 40 Jahren die Anforderungen an die Qualität der Entwicklungsphasen eines neuen Arzneimittels in Bezug auf Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Sicherheit enorm gestiegen.
2.1.1. Vorklinische Entwicklung
Vom Beginn der Wirkstoffsuche bis zur Zulassung eines Arzneimittels vergehen zwischen 12 und 13 Jahre (Breyer et al. 2003). Zu Beginn werden tausende Substanzen untersucht. Mittels Laborrobotern und ähnlicher computergesteuerter Methoden wurde die Suche nach Präparaten in den letzten Jahren stark vereinfacht und beschleunigt. Viel versprechende Substanzen – in dieser Phase nur noch ca. 100 – werden als so genannte Leitsubstanzen weiter untersucht und Tests an Tieren unterzogen. Besonders wichtig sind dabei die toxikologischen Tests, die feststellen, ob Substanzen überhaupt an Menschen getestet werden können. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der vorklinischen Phasen einer öffentlich-rechtlichen Ethik-Kommission vorgelegt. Ethik-Kommissionen bestehen aus Medizinern, Theologen, Juristen und fachfremden Mitgliedern und unterliegen internationalen Standards. Sie sind gesetzlich im deutschen Arzneimittelgesetz (AMG) verankert. Erst nach der Zustimmung einer Ethik-Kommission und der Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) kann der klinische Teil der Arzneimittelentwicklung beginnen (de la Haye, Gebauer 2008; Verband Forschender Arzneimittelhersteller - VFA 2004).
2.1.2. Klinische Entwicklung
Die klinische Entwicklung eines Medikamentes gliedert sich in drei bzw. vier Phasen. Die vierte Phase zählt nicht zur klassischen klinischen Entwicklung, da sie erst nach der Zulassung einsetzt.
Für alle klinischen Studien gibt es gesetzliche Vorschriften (AMG) sowie nationale und internationale Richtlinien. Neben vielen anderen zählt dazu als wichtige internationale Grundlage die „Gute Klinische Praxis“ (Good Clinical Practice – GCP), die die wissenschaftliche Durchführung der Studien vorschreibt (de la Haye, Gebauer 2008).
Nachdem eine Substanz für Tests an Menschen für tauglich befunden wurde, wird sie in Phase I Studien zuerst an einer kleinen Gruppe (n=60-80) gesunder Menschen getestet. Dabei geht es um die Verträglichkeit des Wirkstoffes. Anschließend wird in Phase II an 100-500 erkrankten Menschen die Wirksamkeit getestet. Außerdem soll in Phase II Studien die geeignete Dosis für die Substanz gefunden werden. In Phase III finden so genannte Zulassungsstudien statt. Die Studien werden mit 1000-5000 Patienten durchgeführt. Ziel dieser Phase ist, die Wirksamkeit eines Wirkstoffes an einer großen Population zu beweisen. Außerdem muss die Vorteilhaftigkeit gegenüber anderen bereits zugelassenen Medikamenten bewiesen werden. Es gibt zwei Arten von Zulassungsstudien. Zum einen kann man Placebo-Studien durchführen, bei denen das neue Arzneimittel gegen ein Scheinpräparat getestet wird und zum anderen kann man gegen die gängige Standardtherapie testen. Diese Studien nennt man „kontrolliert“, da jeweils eine Vergleichsebene gegeben ist. Placebo-Studien werden oft doppelblind durchgeführt, d.h. dass weder die Patienten noch die behandelnden Ärzte wissen, mit welcher Therapie der jeweilige Patient behandelt wird (Prinz 2009).
Nach der erfolgreichen Durchführung aller Studien muss ein Antrag auf Zulassung bei der zuständigen Behörde eingereicht werden.
Wenn ein neues Arzneimittel für den Markt zugelassen wurde, beginnt die vierte Phase der klinischen Entwicklung. Während dieser Phase werden über Jahre die Langzeitwirkungen des Medikamentes beobachtet. Treten nach längerer Zeit unvorhergesehene, riskante Nebenwirkungen auf, kann es passieren, dass die Zulassungsbehörde ihre Zulassungsgenehmigung zurückzieht (Schuster 2010).
2.1.3. Zulassung eines neuen Arzneimittels
Nach Erfolg versprechender Beendigung der Phase III der klinischen Entwicklung erstellt das Pharmaunternehmen ein Zulassungsdossier, das alle relevanten Daten zur Entwicklung des Arzneimittels enthält. Dieses wird entweder dem BfArM vorgelegt oder, für eine europaweite Zulassung, der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency – EMEA) (Wagner 2009).
Auch in diesem Bereich gibt es diverse gesetzliche Vorschriften, nationale und internationale Richtlinien. Auf europäischer Ebene bemüht man sich um eine Harmonisierung der Arzneimittelzulassung. In diesem Zusammenhang wurde die EMEA gegründet, die derzeit vier verschiedene Zulassungsverfahren für die Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraumes koordiniert (Schamp, Regenold, Jordan 2008).
Eine internationale Richtlinie gibt die International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) vor, die eine Harmonisierung der drei führenden Arzneimittelregionen Europa, USA und Japan anstrebt. Sie sieht die Erstellung eines Common Technical Documents (CTD) vor, welches nach einem vorgegebenen formalen und inhaltlichen Aufbau sämtliche Ergebnisse bezüglich der Qualität, Wirksamkeit und Verträglichkeit des gesamten Entwicklungsprozesses dokumentiert. Seit 2003 ist es in der Europäischen Union Pflicht, den Zulassungsanträgen ein CTD zuzufügen (Schamp, Regenold, Jordan 2008; ICH 2010).
Nach einer Marktzulassung sind Pharmaunternehmen verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte über die Unbedenklichkeit von Arzneimitteln einzureichen. Diese werden Periodic Safety Update Reports (PSUR) genannt (AMG 2005).
2.1.4. Kosten der Arzneimittelentwicklung
Aufgrund der aufwendigen Forschung und Entwicklung (F&E) sind die Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels sehr hoch. Durch bereits erwähnte staatliche Eingriffe und erhöhte Anforderungen an die Qualität und Sicherheit vorklinischer und klinischer Studien sind die Kosten im Zeitverlauf enorm gestiegen.
In der Literatur findet man verschiedene Zahlen zu den Gesamtkosten der Entwicklung eines Arzneimittels. Dabei ist es immer wichtig, die Zahlen differenziert zu betrachten. Auf welche Medikamente beziehen sich die Kosten? Was sind die Kostenkomponenten?
Thierolf (2008) betrachtet die Entwicklungskosten etwas genauer. Er schätzt die Kosten für die Entwicklung eines Arzneimittels auf mehr als 1 Mrd. US-Dollar. Diese hohe Zahl kommt dadurch zustande, dass er die Kosten für Fehlversuche mit einrechnet. In Tabelle 2.1. sind die Ausfallrisiken der verschiedenen Phasen der Arzneimittelentwicklung dargestellt.
Tabelle 2.1. Entwicklungszeiten und Erfolgswahrscheinlichkeiten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Thierolf (2008), S. 120
Wenn man die teilweise sehr hohen Ausfallrisiken beachtet, ist es nachvollziehbar, wie Kosten in Höhe von über 1 Mrd. US-Dollar entstehen. Etliche Fehlversuche, selbst in späteren Stadien der Entwicklung, müssen mitfinanziert werden.
Betrachtet man nur die direkten Kosten belaufen sich die Gesamtkosten eines neuen Arzneimittels auf 672 Mio. US-Dollar (ebd.).
Wie schon erwähnt, gibt es auch andere Angaben zu den Kosten einer Arzneimittelentwicklung. Breyer et al. (2003) schätzt die Kosten für eine neue Substanz beispielsweise auf 250-350 Mio. US-Dollar. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) (2009c) hingegen spricht von durchschnittlich 800 Mio. US-Dollar für ein neues Arzneimittel mit neuem Wirkstoff (für das Jahr 2001). Im Pharmaceutical Industry Profile der Pharmaceuticel Research and Manufacturers of America (PhRMA 2010) werden Arzneimittelentwicklungskosten im Jahr 2005 in Höhe von 1,3 Mrd. US-Dollar angegeben. De la Haye und Gebauer (2008) gehen dazu im Vergleich von relativ geringen Entwicklungskosten (rund 618 Mio. US-Dollar)[1] aus.
Es wird deutlich, dass die Recherchen und Angaben sehr unterschiedlich sind. Beispielsweise ist es entscheidend, ob sich die Entwicklungskosten nicht nur auf ein neues Arzneimittel, sondern auch auf einen neuen Wirkstoff beziehen. Die Entwicklung eines gänzlich neuen Wirkstoffes ist natürlich teurer als die Neuzusammensetzung bekannter Wirkstoffe.
Nach Angaben von Schaaber (2009), der sich auf Kostenschätzungen in Höhe von 800 Mio. US-Dollar beruft, ist die Höhe der Entwicklungskosten wesentlich geringer als von der Pharmaindustrie angegeben. Er argumentiert, dass bei den Kostenangaben beispielsweise keine Steuerbegünstigungen der Pharmaunternehmen berücksichtig sind. Außerdem beziehen sich die Aussagen der Pharmaindustrie auf die Entwicklung neuer Substanzen, wobei diese nur gut ein Drittel aller Neuzulassungen in den USA ausmachen sollen. Ein weiterer Punkt, den Schaaber anspricht, ist die Finanzierung der Entwicklung neuer Arzneimittel, da die Basisforschung oft auf staatliche Forschungsleistungen zurückzuführen ist. Allerdings berücksichtig er in seinen Ausführungen nicht die bereits erwähnten Kosten durch Fehlversuche, die auch mittels hoher Medikamentenpreise kompensiert werden müssen.
Aufgrund verschiedener Ansätze und ungenauer Angaben bei der Darstellung von Entwicklungskosten für neue Arzneimittel ist es sehr schwierig sich ein Bild von der tatsächlichen Ausgabenbelastung der Pharmaunternehmen zu machen, die damit ihre Medikamentenpreise begründen.
Fest steht, dass die Erforschung neuer Arzneimittel eine sehr diffizile Wissenschaft ist und dass bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit eines Wirkstoffes von 1:10.000 und höchsten Anforderungen an die Durchführung der Studien erhebliche Kosten entstehen.
Um den Arzneimittelmarkt für Pharmaunternehmen attraktiv zu machen, gibt es staatliche Regulationen, die den Pharmaherstellern erhöhte Erträge sichern. Dazu zählt der Patentschutz.
2.2. Patente
Patente dienen dem Schutz des geistigen Eigentums. Damit spielen sie eine enorm wichtige Rolle in der Arzneimittelindustrie. Ohne Patente wären die Informationen und Erkenntnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu neuen Arzneimitteln öffentliche Güter und damit für jedermann zugänglich. Trittbrettfahrer könnten sich der Informationen bedienen und, ohne die sehr hohen Kosten der F&E tragen zu müssen, preisgünstige Medikamente auf den Markt bringen. Um Anreize für die Arzneimittelforschung zu setzen, können Wirkstoffe patentiert werden. Damit wird ein alleiniges Herstellungs-, Vermarktungs- und Vertriebsrecht gewährt. Die zeitliche Dimension eines Patents erstreckt sich über 20 Jahre (Breyer et al. 2003).
2.2.1. Vorraussetzungen und Auswirkungen
Um ein Patent zu bekommen muss man die nach dem Patentgesetz festgelegten Kriterien der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit erfüllen. Bei der Patentanmeldung muss der Antragsteller genau dokumentieren, was er patentieren lassen möchte. Diese Informationen werden veröffentlicht, um vollständige Transparenz für Wettbewerber zu gewährleisten. Dadurch soll zum einen Rechtssicherheit für Dritte gegeben werden und zum anderen der technische Fortschritt vorangetrieben werden. Spätestens 18 Monate nach der Antragstellung sind die Daten zu veröffentlichen. Um Innovationsforschung sicher zustellen, gibt es das Versuchsprivileg, welches die Nutzung der patentierten Daten und Erfindungen durch Dritte erlaubt, um Innovationen weiter zu entwickeln (VFA 2005). Patente dienen also nicht nur dem Schutz der Innovatoren und damit ihrer Kostendeckung, sondern bilden auch die Basis für Arzneimittelforschung und tragen damit zum Wirtschaftswachstum bei (Europäische Kommission 2009).
Patente werden weltweit nach zwei verschiedenen Methoden erteilt. Die Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit wird u.a. nur in Deutschland, der USA und Japan durchgeführt. In anderen Ländern, wie Frankreich und Italien, müssen nur formale Vorraussetzungen erfüllt sein, um ein Patent zu erhalten (VFA 2005).
Man unterscheidet verschiedene Arten von Patenten. Das wichtigste und wirkungsstärkste ist das Erzeugnispatent. Oft sind Erzeugnispatente gemeint, wenn allgemein von Patenten gesprochen wird. In diesem Fall wird ein Wirkstoff patentiert, wodurch ein Ausschließlichkeitsrecht für den Patentanmelder entsteht. Weiterhin können Verfahrenspatente angemeldet werden. Sie sind wesentlich schwächer als Erzeugnispatente, da sie nur eine spezielle Verfahrensweise zur Herstellung von Arzneimitteln schützen. Soll ein Verfahrenspatent angemeldet werden, dessen Verfahren die Benutzung eines erzeugnispatentierten Wirkstoffes vorsieht, muss erst die Zustimmung des Patentinhabers für den Wirkstoff eingeholt werden. Das Verfahrenspatent ist dann ein abhängiges Patent. Eine dritte Patentart stellt das Verwendungspatent dar. Dieses Patent schützt ausschließlich die Indikation, für die ein Wirkstoff zugelassen ist. Auch hier kann es wieder zu Abhängigkeitsverhältnissen kommen. Das Verwendungspatent bietet einen eher geringen Schutz gegenüber den anderen Patentarten, da beispielsweise Ärzte nicht daran gebunden sind (ebd.).
Außerdem spricht man von Primär- und Sekundärpatenten. Primärpatente sind gleich zusetzten mit Erzeugnispatenten, da sie einen Wirkstoff betreffen. Sekundärpatente können Verfahrens- oder Verwendungspatente sein. So genannte Blockbuster-Medikamente[2] haben oft eine ganze Reihe verschiedener Patente in ihrem Patentportfolio (Europäische Kommission 2009).
Da Patente schon sehr zeitig im Entwicklungsprozess der Arzneimittelforschung angemeldet werden und zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, welcher der untersuchten Wirkstoffe zum Erfolg führen könnte, werden oftmals mehrere Patente für verschiedene Wirkstoffe angemeldet. In diesem Fall und bei Überschneidungen von unterschiedlichen Patenten, die zu Patentabhängigkeiten führen, bietet es sich für Pharmaunternehmen an, Lizenzen zu verkaufen und somit ihre Patente gewinnbringend zu nutzen. In bestimmten Fällen, beispielsweise bei besonderem öffentlichem Interesse an einer speziellen Erforschung, ist es für Wettbewerber möglich, Zwangslizenzen zu erwirken (VFA 2005).
Grundsätzlich differenziert man zwischen drei verschiedenen Arzneimittelgruppen am Markt. Es gibt Originalpräparate, Analogpräparate (auch me-too-Präparate) und Generika. Originalpräparate sind durch Erzeugnispatente für eine bestimmte Zeit vor Generikaherstellern, also Herstellern von qualitativ und quantitativ gleichartig zusammengesetzten Arzneimittelprodukten, geschützt (Hofmann, Schöffski 2008). Durch die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Forschungs- und Entwicklungsdokumente dauert es allerdings im Schnitt nur vier Jahre bis Analogpräparate auf den Markt kommen. Sie unterscheiden sich in ihrem Wirkstoff-Design nur minimal von den Originalpräparaten, bieten aber mitunter pharmakokinetische Verbesserungen oder haben weniger Nebenwirkungen. Da der Patentschutz der Originalwirkstoffe zu dieser Zeit noch besteht, müssen Hersteller von me-too-Präparaten eigene Studien durchführen. Die Kosten für ein Analogpräparat liegen bei zwei Dritteln der Durchschnittsgesamtkosten eines Originalwirkstoffes. Analogpräparate werden ebenfalls patentiert.
Mit Auslaufen des Patentes für Erstanbieter drängen Generikahersteller auf den Markt. Da sie sich auf die von den Erstanbietern durchgeführten Studien berufen können, sind ihre Kosten und Risiken sehr gering. Aus diesem Grund können sie preisgünstig anbieten (Prinz 2009).
Neben der Länge der Patentschutzzeit von 20 Jahren spielt die effektive Patentlaufzeit eine entscheidende Rolle. Da Patente angemeldet werden, sobald ein therapeutischer Erfolg eines Präparates absehbar ist und eine Entwicklungszeit von ca. 12 Jahren zu bedenken ist, kann die Monopolstellung aufgrund des Patentes am Arzneimittelmarkt nur rund 7-10 Jahre ausgenutzt werden (Breyer et al. 2003). Würden Patente erst später angemeldet werden, wären die Risiken zu groß, dass andere Pharmafirmen schneller sind und vorher Patente anmelden. Das würde massive Verluste für einen Pharmahersteller bedeuten, der zu diesem Zeitpunkt bereits Millionen in die F&E eines neuen Arzneimittels investiert hat (VFA 2005). Da sich sowohl die Entwicklungszeit als auch die Zulassungszeit stetig verlängert haben, gibt es die Möglichkeit ein Ergänzendes Schutzzertifikat (Supplementary Protection Certificate – SPC) zu beantragen. Dadurch kann eine Verlängerung der Schutzzeit um fünf Jahre auf maximal 15 Jahre erreicht werden. Bevor ein neues Arzneimittel auf den Markt tritt werden bereits weit reichende Maßnahmen ergriffen, um die Länge der Zulassungsbearbeitungszeit zu kompensieren. Der Markt wird medienwirksam auf die Innovation vorbereitet, indem Werbekampagnen gestartet werden und das Produkt schon so genannten Target Groups (ärztlichen Zielgruppen) präsentiert wird (Guminiski 2008). Mit dem Auslaufen eines Patentes versuchen die Pharmaunternehmen die Verlängerung eines Schutzes zu erwirken. Dafür werden SPC’s beantragt oder zusätzliche Studien für spezielle Gruppen (z. B. Kinder) durchgeführt, um weitere Schutzmöglichkeiten nutzen zu können (Raasch, Schöffski 2008).
2.2.2. Probleme
Die Gründe für Patentvergaben sind in Bezug auf Innovationsforschung und wirtschaftliche Anreize für Pharmaunternehmen nachvollziehbar. Wenn man Patente allerdings aus wohlfahrtstheoretischer Sicht betrachtet, sind sie durchaus problematisch. Sie schaffen, zumindest für eine gewisse Zeit, künstliche Monopole, die für die Gesellschaft einen Wohlfahrtsverlust mit sich bringen. Laut Prinz (2009) sind rund 70% der F&E auf Nachahmerprodukte ausgerichtet, anstatt nach Innovationen zu forschen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es selten auf Anhieb wirkliche Innovationen gibt. Vielmehr ist die Erforschung von Innovationen ein stufenartiger Prozess, der sich durch die Nachahmung, aber auch Verbesserung von Originalpräparaten ergibt. Wirtschaftlich gesehen stellt diese Situation dennoch ein Dilemma dar. Dadurch, dass sich Hersteller von Analogpräparaten nicht auf die Studienergebnisse der Erstanbieter berufen dürfen, müssen sie eigene Studien durchführen, die natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden sind. Es gibt also zahlreiche Mehrfachstudien und damit auch extreme Mehrkosten, die dem Schutz der Innovatoren gegenüber stehen. Trotz allem scheint es derzeit keine überlegene Alternative zum Patentschutz zu geben (Prinz 2009).
2.2.3. Patentorganisationen
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung wird es immer dringlicher, ein einheitliches Patentrechtssystem zu entwickeln. Bisher gibt es regionale, nationale und internationale Patente, die erworben werden können. Für sie gilt dann jeweils nationales Recht. Dadurch entstehen erhebliche Mehrkosten für Unternehmen, die ihre Produkte auch international vermarkten möchten (VFA 2005).
Der Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty – PCT) und das Europäische Patentübereinkommen sind nur zwei Maßnahmen, welche die internationale Patentanmeldung vereinfachen sollen. Der PCT ermöglicht eine schnelle und einheitliche Patentanmeldung in mehr als 100 Ländern weltweit. Für Mitglieder der Europäischen Patentorganisation (EPO) bewirkt das Europäische Patentübereinkommen ein homogenes Anmeldungsverfahren beim Europäischen Patentamt (ebd.).
Auf internationaler Ebene wurden innerhalb der Welthandelsorganisation (World Trade Organization – WTO) Mindeststandards für Patente festgesetzt, die von den Mitgliedsstaaten der WTO in das jeweilige nationale Recht integriert werden müssen. Diese Mindeststandards wurden innerhalb des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) festgelegt und betreffen beispielsweise die Länge der Patente oder spezielle Regelungen zu Zwangslizenzen. Neben dem TRIPS ist auch die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization – WIPO) maßgeblich an der weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beteiligt. Unterstützung finden diese Bemühungen von allen beteiligten Akteuren, da von großen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch Gemeinschaftspatente ausgegangen wird (VFA 2005, Europäische Kommission 2009).
2.3. Arzneimittelpreise
Arzneimittel werden von Patienten und verschreibenden Ärzten selten als knappes Gut gehandelt, weil sie nur unmittelbar von den Auswirkungen ihres Handelns betroffen sind. Der Staat allerdings finanziert das Sozialversicherungssystem und hat deshalb ein erhöhtes Interesse daran, die öffentlichen Arzneimittelausgaben zu minimieren. Das unterentwickelte Preisbewusstsein der Leistungsanbieter und Leistungsnehmer führt zu einer ineffizienten Verteilung der knappen Ressourcen. Moral Hazard spielt beim Konsum der Patienten eine Rolle, obwohl sich erhöhte Arzneimittelausgaben langfristig negativ auf die Versicherungsprämien der Versicherten auswirken (Breyer et al. 2003).
Pharmahersteller können die Preise für verschreibungspflichtige Arzneimittel grundsätzlich frei wählen. Vor allem für patentgeschützte Medikamente gelten oft sehr hohe Preise. Dennoch unterliegen sie vielfachen indirekten Preisregulierungen (Bundesministerium für Gesundheit – BMG 2010a).
2.3.1. Regulierungsinstrumente
Um die steigenden Gesundheitsausgaben in den Griff zu bekommen, gibt es seit den 1970er Jahren verschiedene Modelle zur Preisregulierung. Der Arzneimittelmarkt gehört zu den am stärksten regulierten Märkten überhaupt.
In Deutschland werden seit 1989 Festbeträge als Regulierungsinstrument angewendet. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Er ist vom Gesetzgeber beauftragt, durch Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu bestimmen und entscheidet somit rechtsverbindlich über den Leistungsanspruch der ca. 70 Mio. gesetzlich Krankenversicherten. Eine weitere Aufgabe des G-BA ist die Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen (G-BA 2010). Konkret legt der G-BA Festbetragsgruppen fest, die vergleichbare Arzneimittel enthalten. Der Spitzenverband der GKV setzt dann für die verschiedenen Gruppen Festbeträge fest. Arzneimittelhersteller können ihre Preise auch oberhalb des Festbetrags setzen, allerdings muss die Differenz zum Festbetrag dann privat von den Patienten bezahlt werden. Außerdem ist eine Zuzahlung in Höhe von 10 %, mindestens 5 Euro bzw. höchsten 10 Euro je Packung zu entrichten (BMG 2009). Die Festbetragsregelung gilt in der Regel nicht für patentgeschützte Arzneimittel mit neuartigem Wirkstoff oder einer therapeutischen Verbesserung (im Folgenden als innovative Arzneimittel bezeichnet). Sie beeinflusst vor allem den Preiswettbewerb auf dem generikafähigen Markt und übt einen erheblichen Preisdruck auf Produkte mit abgelaufenem Patentschutz aus (Fricke 2008).
Für Arzneimittel, die nicht in einer Festbetragsgruppe sind, legt der G-BA Erstattungshöchstbeträge fest, die maximal von der GKV vergütet werden. Diese Beträge werden auf der Grundlage von Gutachten des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)[3] gebildet (Pirk 2008).
Ein weiteres Regulierungsinstrument ist die direkte Preisregulierung, die in Frankreich oder Italien angewendet wird. In Verhandlungsrunden werden die Arzneimittelpreise festgesetzt (Breyer et al. 2003).
In Großbritannien werden die Arzneimittelausgaben über die Renditeregulierung kontrolliert. Pharmaunternehmen handeln mit der Regierung eine Kapitalrendite (Großbritannien: 17-21 %) aus. Solange die Kapitalrendite in diesem Bereich liegt, können die Arzneimittelhersteller beliebige Preise festlegen (ebd.).
Außerdem sind seit einiger Zeit Rabattverträge in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Je nach Arzneimittelgruppe sind verschiedene Rabattsätze zwingend, die Pharmaunternehmen den Krankenkassen gewähren müssen. Zunehmend spielen auch eigenständige Rabattverträge für Generika zwischen Pharmaunternehmen und Krankenkassen eine größere Rolle, da hier erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden können, die direkt an die Versicherten weiter gegeben werden können (Bundesministerium für Gesundheit - BMG 2010a). Derzeit werden 60% der Medikamente des generikafähigen Marktes über Rabattverträge angeboten (IMS Health 2010).
Eine weitere staatlich unterstützte Preisregulierung der GKV ist die Importförderung von Arzneimitteln. Dazu gibt es einen Rahmenvertrag zwischen dem Spitzenverband der GKV und dem Apothekerverband, der Apotheken zur Abgabe von importierten preisgünstigeren Arzneimitteln verpflichtet. Dadurch werden Preisdifferenzen ausgenutzt, die aufgrund von internationalen Preisunterschieden und nationalen Preisregulierungen entstehen (Fricke 2008).
Diese Regulierungen schlagen sich auf unterschiedliche Art und Weise im Preiswettbewerb nieder.
2.3.2. Preiswettbewerb
Man unterscheidet auf dem Arzneimittelmarkt zwischen drei verschiedenen Preiswettbewerben.
Der erste Wettbewerb findet zwischen Innovator und Imitator statt. Zunächst bietet der Innovator sein Produkt mit einer Monopolstellung am Markt an, welche durch den Patentschutz gewährleistet ist. Dadurch stellt sich ein relativ hoher Preis ein, der mit einem Wohlfahrtsverlust für die Gesellschaft einhergeht. Nach ca. vier Jahren treten erste Anbieter von Analogpräparaten auf den Markt, die ebenfalls patentgeschützt sind. Unter der Annahme, dass nur ein Anbieter auf den Markt kommt, stellt sich eine Duopolsituation ein. In Folge dessen sinken die Preise und der Wohlfahrtsverlust. Nach Patentablauf treten umgehend Generika-Anbieter auf den Markt und es stellt sich ein zweiter Wettbewerb zwischen dem Originalpräparat und den wesentlich billigeren Generika ein. Das Originalmedikament verliert im ersten Jahr nach Patentablauf 44 % seines Marktanteils (Prinz 2009). Wie stark die Preise fallen hängt von den staatlichen Regulierungen ab.
Die dritte und stärkste Form des Preiswettbewerbs findet zwischen den verschiedenen Generika-Anbietern statt. Dieser Wettbewerb ist staatlich erwünscht und wird deshalb auch gefördert, damit die Arzneimittelpreise so gering wie möglich sind (ebd.).
Um die Preise für patentgeschützte Arzneimittel besser kontrollieren zu können und die Gesundheitsausgaben besser dämpfen zu können, gibt es zahlreiche Ansätze zur Neustrukturierung des Arzneimittelmarktes. Einige davon werden im nächsten Abschnitt kurz vorgestellt.
2.3.3. Maßnahmen zur Neustrukturierung des Arzneimittelmarktes
Das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) von 2004 hat das IQWiG im Sozialgesetzbuch V (SGB V) gesetzlich verankert. Das unabhängige, wissenschaftliche Institut arbeitet im Auftrag des G-BA und BMG, sowie in Eigenverantwortung. Es erstellt objektive Kosten-Nutzen-Analysen innovativer patentgeschützter Arzneimittel, welche die Basis für Entscheidungen des G-BA beispielsweise in Bezug auf Erstattungshöchstbeträge bilden. „Die Bewertung erfolgt durch Vergleich mit anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen unter Berücksichtigung des therapeutischen Zusatznutzens für die Patienten im Verhältnis zu den Kosten.“ (§35b I 3 SGB V) In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das IQWiG Methodenpapiere, die die Arbeitsweise des Institutes erläutern. Finanziert wird das IQWiG durch Kassenbeiträge der Versicherten (IQWiG 2010).
International werden häufig qualitätskorrigierte Lebensjahre (Qualitiy-Adjusted Life Years – QALY) als Bewertungsinstrument zur Integration von Lebensqualität verwendet. Diese Methode berücksichtigt eine qualitative und eine quantitative Dimension zur Bestimmung einer Kennzahl, die den Nutzwert für ein Lebensjahr darstellt und somit Lebensqualitätseffekte in Kosten-Nutzen-Analysen integrieren kann (Schöffski, Fricke 2008). Das IQWiG steht diesem Instrument aufgrund methodischer und ethischer Bedenken kritisch gegenüber (Foos et al. 2010). Da das Institut bisher keine relevanten Alternativen zur Integration von Lebensqualität vorweisen kann, wird es von Seiten der pharmazeutischen Industrie und einiger Wissenschaftler aufgefordert, Lebensqualität stärker in seinen Bewertungen zu berücksichtigen (VFA 2009a).
Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) von 2007 führte die gemeinsame Bestimmung von Erstattungshöchstbeträgen für innovative, patentierte Arzneimittel ein. Grundlage dafür sind, wie schon erwähnt, die Analysen des IQWiG. Damit wird erstmals auch die Preissetzung für innovative, patentgeschützte Medikamente indirekt reguliert. Allerdings ist zu bedenken, dass die Basis der Entscheidungen über Erstattungshöchstbeträge Analysen sind, die von einer einzelnen Bewertungsinstanz durchgeführt werden. Die zentrale Erstattungsregulierung beschränkt also möglicherweise Patienten, da diese nicht selbstständig über ihre Krankenkassenwahl aufgrund eigener Bewertungen entscheiden können (Bungenstock 2008).
Bungenstock schlägt dazu vor, dass der Staat Erstattungshöchstbeträge vorgibt. Die Krankenkassen sollen flächendeckend einen Basisleistungskatalog anbieten, der die Erstattungshöchstbeträge berücksichtigt. Für alle zusätzlichen Leistungen werben Pharmaunternehmen direkt bei den Krankenkassen für ihre Produkte und schließen individuelle Verträge mit ihnen ab. Dadurch können sich Krankenkassen gezielt auf bestimmte Patientengruppen spezialisieren und dabei unter Umständen auch Zusatzbeiträge erheben. Patienten können frei wählen, bei welcher Krankenkasse sie sich entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse versichern wollen (ebd.).
Im Zuge des Regierungswechsels 2009 sind weitere Reformanstrengungen im Bereich des Arzneimittelmarktes geplant, die den Vorschlag Bungenstocks teilweise aufgreifen. Beispielsweise soll die Organisation der Krankenkassen dezentralisiert werden, indem Vertragsverhandlungen zwischen Pharmafirmen und Krankenkassen direkt stattfinden. Dafür müssen Pharmaunternehmen eigene Studien vorlegen, die den Nutzen ihrer innovativen Arzneimittel belegen. Diese werden vom G-BA und IQWiG geprüft und bilden die Grundlage für Vertragsverhandlungen. So sind die Preise für innovative Arzneimittel erstmals nicht mehr alleine durch die Pharmaunternehmen bestimmbar. Außerdem sollen Rabattverträge für Generika verändert werden, die den Wettbewerb intensivieren sollen (BMG 2010b).
[...]
[1] 500 Mio. Euro mit einem Wechselkurs von 0,8092 umgerechnet. (Stand: 15.05.2010)
[2] Medikamente, die ein Umsatzvolumen von mehr als 1 Mrd. US-Dollar erreichen. (Thierolf 2008)
[3] Vgl. Abschnitt 2.3.3. dieser Arbeit
Details
- Titel
- Ökonomische Aspekte der Entwicklung neuer Arzneimittel unter besonderer Berücksichtigung kleiner Nutzergruppen
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 61
- Katalognummer
- V297817
- ISBN (Buch)
- 9783958200135
- ISBN (PDF)
- 9783958205130
- Dateigröße
- 1694 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Pharmaindustrie Orphan Drugs Gesundheitsökonomie Kosten Arznei Medikamente
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2010, Ökonomische Aspekte der Entwicklung neuer Arzneimittel unter besonderer Berücksichtigung kleiner Nutzergruppen, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297817
- Angelegt am
- 29.4.2015
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.