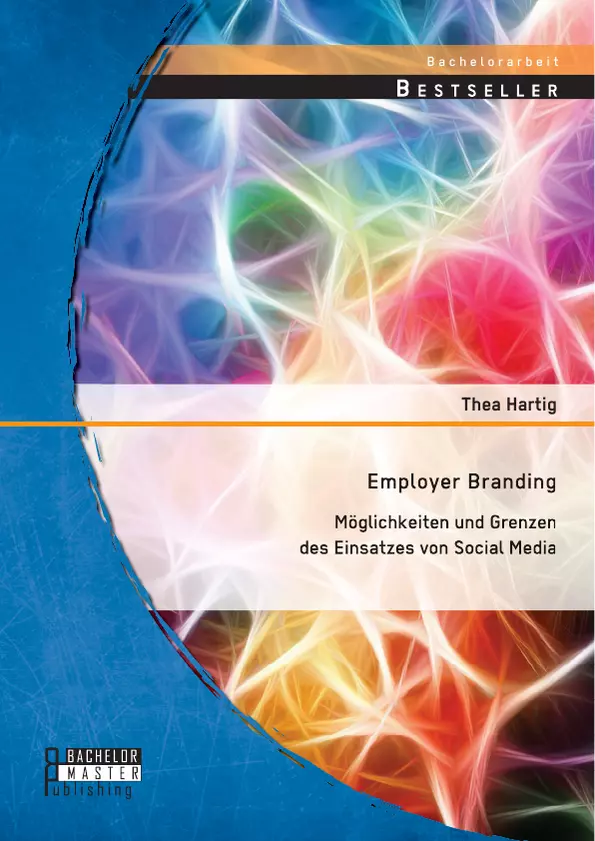Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos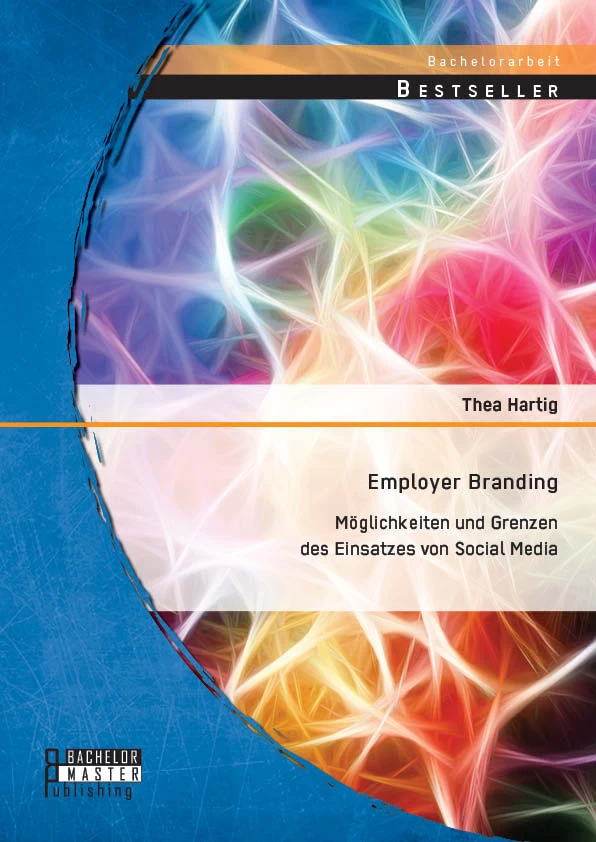
Employer Branding: Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Social Media
Bachelorarbeit, 2011, 57 Seiten
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Autor

Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
2.1.1 Relevanz und Ursprung des Employer Branding
Die Erkenntnis, dass qualifizierte, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter zentrale Bestimmgrößen unternehmerischen Erfolges[1] sind (vgl. DGFP e.V. 2006: 14-15), hat sich bereits auf breiter Ebene sowohl in Wissenschaft als auch Unternehmenspraxis etabliert. Sie findet Niederschlag im Konzept des Resource Based View of Competition (vgl. Backhaus/ Tikoo 2004: 501, 503).[2] Durch den Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft (vgl. o.A. 2011a: 9) wird die Bedeutsamkeit der in der ökonomischen Literatur als Humankapital[3] bezeichneten Mitarbeiter noch wachsen. Dieser Übergang ist auf den nationalen Anstieg des Dienstleistungsanteils am Bruttosozialprodukt, der sich mit der vom Lohngefälle begünstigten Verlagerung arbeitsintensiver Herstellungsprozesse von Europa nach Asien erklärt, zurückzuführen. Es wird prognostiziert, dass wissensintensive Branchen die Wertschöpfungsbereiche der Zukunft sind, d.h. ohne kompetente und gut ausgebildete Mitarbeiter als immateriellen Vermögenswert wird kein Unternehmen langfristig am Markt bestehen können (vgl. Beck 2008a: 5). Mit dieser Transformation steigen die Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter (vgl. Wiese 2005: 17).
Trotz zahlreicher Arbeitsuchender wird es für Unternehmen immer schwerer, potentielle Leistungsträger zu finden, die den zunehmend anspruchsvolleren und wissensintensiveren Aufgaben begegnen können. Man spricht vom Fachkräftemangel,[4] der besonders die Bereiche Forschung & Entwicklung sowie Informationstechnologie betrifft (vgl. Weitzel/ Eckhardt/ von Stetten/ Laumer 2011a: 4). Dem allgemein verstärkten Bedarf an hoch qualifizierten Mitarbeitern und insbesondere Nachwuchskräften (vgl. Tochtermann 2003: 889), sogenannten High Potentials im Alter von 22 bis 35 Jahren, steht ein nur knappes Angebot gegenüber. Dies ist auf den demografischen Wandel zurückzuführen, mit dem die Verkleinerung des Bewerberpools insgesamt einhergeht. Verschärfend dazu führen Defizite im Bildungsbereich, die mit PISA und dem Bologna-Prozess verschlagwortet werden, zu einer abnehmenden Bildungsqualität der verfügbaren Hochschulabsolventen (vgl. o.A. 2011a: 9).
Bedingt durch den Angebotsengpass an qualifizierten Kandidaten steigt die Wettbewerbsintensität auf dem Humankapitalmarkt an, die als War for Talents [5] ein akutes Problem für Arbeitgeber darstellt (vgl. Wiese 2005: 17-18): Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern bedroht unternehmerisches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen findet in Analogie zur Entwicklung vom Verkäufer- zum Käufermarkt ein Übergang vom Arbeitgeber- in einen Arbeitnehmermarkt statt (vgl. Stotz/ Wedel 2009: 47), in welchem der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs das entsprechende Angebot überwiegt. Unternehmen befinden sich ergo beim »Verkauf« von sich als Arbeitgeber in der Verkäuferposition. Dabei sind die Nachwuchskräfte „einer Informationsüberflutung [...] ausgesetzt“ (ebd.: 48), wodurch ihre Entscheidungsfindung erschwert wird.
Unter den angeführten Umständen wurde der Wert der Markenbildung für den Human Resources (HR)-Bereich[6] erkannt (vgl. Barrow/ Mosley 2005: 9). Während sich Branding im ursprünglichen Bedeutungszusammenhang auf das Brandmarken von Tieren zu Identifikationszwecken bezieht, wie es die Ägypter nachgewiesen bereits 2000 v. Chr. praktizierten (vgl. Danesi 2006: 8), wird der Begriff in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur verwendet, um den Führungsprozess einer Marke zu beschreiben (vgl. Wiese 2005: 32). In der allgemeinen Definition einer Marke als „ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung verstanden“ (Meffert/ Burmann/ Koers 2002: 6)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
schlägt sich nieder, dass bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ausschließlich Produkte und Dienstleistungen mit Marken in Verbindung gebracht wurden. Da sich ein unterscheidbares Vorstellungsbild auch auf Unternehmen bzw. Unternehmen als Arbeitgeber beziehen kann, kann die Definition erweitert werden (vgl. Barrow/ Mosley 2005: 57). Dabei wird das auf ein Unternehmen bezogene Vorstellungsbild als Corporate Brand (Unternehmensmarke) bezeichnet. Wie aus Abb. 1 hervorgeht, stehen einem Unternehmen eine Vielzahl an Anspruchsgruppen (Stakeholder) gegenüber (vgl. Barrow/ Mosley 2005: 48), wobei jede Gruppe dem Unternehmen spezifische, individuelle Interessen entgegen bringt (vgl. Hungenberg 2001: 24). Da die aktuellen, potentiellen und ehemaligen Mitarbeiter eines Unternehmens eine Teilmenge aller Anspruchsgruppen bilden, ist die Employer Brand (Arbeitgebermarke) als Facette der Corporate Brand zu verstehen (vgl. Stotz/ Wedel 2005: 5-6 und Beck 2008b: 31). Die dauerhaft angestrebten Eigenschaften, mit denen sich ein Unternehmen als Arbeitgeber charakterisiert (vgl. Wiese 2005: 25), werden in der Markenidentität zusammengefasst (vgl. Saren 2007: 100), wohingegen man die tatsächlich durch die Employer Brand ausgelösten Vorstellungen als Markenimage bezeichnet (vgl. Haedrich/ Tomczak/ Kaetzke 2003: 17).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Anspruchsgruppen einer Corporate Brand (eigene Darstellung nach Wiese 2005: 24)
Unter Rückbezug auf die allgemeine Markendefinition kann die Employer Brand als ein im Gedächtnis der potentiellen, aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Unternehmen als Arbeitgeber definiert werden (vgl. Stotz/ Wedel 2009: 6 und vgl. Petkovic 2008: 70-71). Um zu einem bevorzugten Arbeitgeber (Employer of Choice) aufzusteigen, ist eine möglichst attraktive Arbeitgebermarke herauszuarbeiten. Employer Branding kann dabei als neuartiges Konzept verstanden werden, das sich von den klassischen Ansätzen des Personalmarketings insofern unterscheidet, als dass es in einer klar definierten Strategie zur Entwicklung der Arbeitgebermarke verankert ist und nicht per se nur auf Mitarbeitergewinnung ausgerichtet ist (vgl. Wiese 2005: 19 und vgl. Stotz/ Wedel 2009: 11).
2.1.2 Effekte der Employer Brand
Wie bereits gesagt, ist Employer Branding als umfassender Ansatz mit dem Ziel der Positionierung eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber zu verstehen. Die Wirkung der Arbeitgebermarke zeigt sich sowohl unternehmensintern im Kreise der aktuellen Mitarbeiterschaft als auch extern auf dem Arbeitsmarkt und dem sonstigem Unternehmensumfeld.[7] Wie Abb. 2 dargestellt, verweist die Deutsche Employer Branding-Akademie (DEBA) auf fünf Wirkungsfelder der Arbeitgebermarke, in denen sich empirisch bestätigt nachhaltige Nutzeneffekte erzielen lassen (vgl. DEBA 2009a). Zu den internen Effekten, die gemäß der Schwerpunktsetzung dieser Arbeit (siehe Kapitel 1.2) nur eine marginale Rolle für den nachfolgenden Argumentationsgang spielen, zählen Wirkungen in den Bereichen Mitarbeiterbindung, Arbeitsleistung und -ergebnis sowie Unternehmenskultur. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber und die Mitarbeiterzufriedenheit kann durch entsprechende Maßnahmen des internen Employer Brandings gesteigert werden, womit der Arbeitgeber innerhalb seiner aktuellen Mitarbeiterschaft als attraktiver wahrgenommen wird. Dadurch kann die Fluktuationsrate gesenkt werden (vgl. Wiese 2005: 29-30). Weil eine attraktive Arbeitgebermarke motiviert, verbessern sich auch Leistungen und Engagement der Mitarbeiter. Mit entsprechenden Maßnahmen kann auch der Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander gestärkt werden, sodass sich das Arbeitsklima verbessert – wodurch natürlich auch eine positive Bestärkung der bereits genannten Wirkungsfelder verursacht wird (vgl. DEBA 2009a). Diese positiven Wirkungen können Eingang in Unternehmenskultur und -werte finden, die intern gelebt werden, aber auch nach außen hin für Interessierte durch den Einsatz als geeignet eingestufter Kommunikationsmittel erlebbar gemacht werden können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Wirkungsfelder der Employer Brand (DEBA 2006)
Zu den externen Effekten des Employer Brandings zählen Aspekte des Arbeitgeberimages und der Mitarbeitergewinnung. Wie auch bei den internen Effekten, bedingen sie sich durchaus gegenseitig. Ein durch die Marke als glaubwürdig wahrgenommener, unverwechselbar wahrgenommener Arbeitgeber genießt eine höhere Reputation im externen Umfeld des Unternehmens. Dies verleiht der Employer Brand das Attribut der Attraktivität und wirkt sich auf die Mitarbeitergewinnung positiv aus. Da qualifizierte Mitarbeiter, wie anfänglich geschildert, als Kernquelle unternehmerischen Erfolges und Innovationskraft in heutiger Zeit betrachtet werden, kann dieses Wirkfeld schlussfolgernd als besonders wichtig bezeichnet werden (vgl. Bleicher 2004: 472).
Abseits der skizzierten Wirkfelder können in Bezug auf die Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberwahl allgemeine Aussagen zu der Wirkung der Employer Brand getroffen werden. Die Arbeitgebermarke erzeugt ein gewisses Image und transportiert bestimmte Werte, sodass sie aus Arbeitgebersicht wie ein „Filter, der gezielt die passenden Kandidaten anzieht und die anderen fernhält“ (DEBA 2009a) wirkt. Das bedeutet, dass auf Stellenanzeigen zwar weniger, dafür aber mehr geeignete Bewerbungen folgen; d.h. Bewerbungen von Kandidaten, die von ihrer Persönlichkeit und ihren Wertvorstellungen zum Unternehmen und seiner Kultur passen. Als ökonomischer Vorteil resultiert daraus eine Senkung der Personalbeschaffungskosten (vgl. Wiese 2005: 28). Aus Bewerberperspektive erleichtert eine starke Arbeitgebermarke – vor dem Hintergrund begrenzter Verarbeitungsfähigkeit des menschlichen Gehirns – die Bewältigung der Entscheidungssituation[8] bei Arbeitgebersuche und -wahl. Durch ihre Bekanntheit und dem Wertversprechen, das sie durch ihre Identität gibt, verringert eine Marke den Such- und Informationsaufwand und vermittelt ein gewisses Maß an Vertrauen, eine richtige Entscheidung zu fällen. Da die der Arbeit zugrunde gelegte Frage aus der Perspektive eines Unternehmens gestellt ist, wird an dieser Stelle verdeutlicht, dass mittels durchdachter Gestaltung von Employer Branding-Maßnahmen dazu beigetragen werden kann, Präferenzen bei der Zielgruppe zu bilden: „Mit Hilfe einer Arbeitgebermarke kann ein Unternehmen [...] im Personalmarkt als einzigartig erscheinen und sich eine [...] Unique Applying Proposition, d.h. ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen“ (ebd.: 28).
2.1.3 Externe Employer Brand-Kommunikation als Employer Branding-Prozessteilschritt
Damit der Arbeitgeber auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden kann, muss die gewünschte Identität erst einmal an die definierte Zielgruppe kommuniziert werden. Kommunikation stellt dabei nur einen Schritt im Employer Branding-Prozess dar, der im Folgenden skizziert wird. Er umfasst laut DEBA „die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber“ (DEBA 2007). Im Sinne moderner identitätsorientierter Markenführung[9] ist der Prozess systematisch in die Phasen Planung, Koordination und Kontrolle aufgegliedert und an einer langfristigen Strategie ausgerichtet, von der entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Die Kommunikation der Arbeitgebermarke (Employer Brand-Kommunikation), die weiteren Gang der Ausarbeitung leitet, ist als operativer Prozessschritt in der Koordinationsphase angesiedelt, wie Abb. 3 illustriert. Gemäß der Schwerpunktsetzung der Arbeit wird die externe Ausrichtung der EB-Kommunikation fokussiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Der idealtypische Verlauf eines Employer Branding-Prozesses(eigene, vereinfachte Darstellung nach Wiese 2005: 40 und Becker/ Schnetzer 2006:99-104 und Burmann/ Meffert/ Feddersen 2007: 12)
In der strategisch ausgerichteten Planungsphase wird die Informationsbasis für den Aufbau und die Entwicklung der Employer Brand geschaffen (vgl. Becker/ Schnetzer 2006: 100). Mittels Segmentierung werden dabei mögliche Zielgruppen auf dem Personalmarkt identifiziert, wodurch es ermöglicht wird, eine gezieltere Ansprache und Bedürfnisbefriedigung der Anvisierten zu konzipieren (vgl. Wiese 2005: 41). Die Situationsanalyse bietet sich als Grundlage für weitere Entscheidungen an, denn sie verweist auf zu erwartende Veränderungen der bestehenden Ist-Situation in der Mikro- und Makroumwelt[10] des Unternehmens. Diese wirken sich auf die Arbeitsmarksituation und somit auf die Gestaltung der langfristigen Employer Branding-Strategie aus (vgl. Wiese 2005: 44-45). Aufbauend auf der Analyse der Situation werden schließlich die strategischen Employer Branding-Ziele festgelegt. Diese sollten aus den Unternehmenszielen abgeleitet werden, da die Employer Brand schließlich als Facette der Corporate Brand zu verstehen ist (vgl. Abb. 1). Dabei konstituiert sich das Hauptziel, die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber (vgl. ebd.: 48), durch die Zielgrößen »Bekanntheit der Arbeitgebermarke« sowie die Qualität des in den Köpfen der Zielgruppe entstandene »Image«.[11]
In der Koordninationsphase wird zunächst die Employer Brand-Identität als Soll-Markenidentität entwickelt (Selbstbild der Marke). Bei der Konzeption sollten die Funktionsweisen der beiden voneinander getrennten Gehirnhälften berücksichtigt werden: Die linke Gehirnhälfte ist verantwortlich für rationale Nutzenabwägung, während das rechte Areal bildhaft-emotional geprägt ist. da sich die Verankerung der Vorstellungsbilder von einer Arbeitgebermarke sowohl in der linken Gehirnhäfte (verantwortlich für rationale Verarbeitung und Nutzenabwägung) als auch im rechten Areal (bildhaft-emotional geprägt) vollzieht (vgl. ebd.: 50). Durch die Kommunikation sachlich-rationaler, aber auch emotionaler Argumente wird gewährleistet, dass die Employer Brand ganzheitlich gespeichert wird. Im Anschluss an die Definition der Soll-Arbeitgebermarkenidentität ist es das Bestreben, mittels operativer Maßnahmengestaltung (Umsetzung der Employer Brand-Identität) eine möglichst geringe Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher Ist-Arbeitgeberidentität (Image als Fremdbild der Marke) zu erzielen (vgl. Becker/ Schnetzer 2006: 100). Da Marken durch Kommunikation lebendig werden und bleiben, werden Kommunikationsmaßnahmen im Employer Branding-Prozess eine hohe Priorität bei der Vermittlung der Arbeitgebermarke an die Zielgruppe beigemessen (vgl. Schuhmacher/ Geschwill 2009: 38 und vgl. Wiese 2005: 62). Da die Employer Brand sowohl an interne als auch externe Anspruchsgruppen vermittelt wird, kann zwischen interner und externer Employer Brand-Kommunikation unterschieden werden. Wie Abb. 4 visualisiert, kann die Kommunikation persönlich oder mediengestützt erfolgen.
Die interne Employer Brand-Kommunikation, die ihren Ausdruck im persönlichem Mitarbeitergespräch oder in mediengestützter Form (z.B. Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, E-Mail) findet (vgl. DEBA 2009b), vermittelt die herausgearbeitete Wunsch-Arbeitgeberidentität ins Unternehmen. Sie begleitet den Arbeitnehmer vom Unternehmenseintritt bis zum -austritt (vgl. Stotz/ Wedel 2009: 11). Dahingegen richtet sich die externe Employer Brand-Kommunikation nach außen, um das Unternehmen bei Externen als Employer of Choice zu etablieren (vgl. Backhaus/ Tikoo 2004: 503). Der Vorteil persönlicher face-to-face-Kommunikation, z.B. bei Fachvorträgen und Seminaren liegt gegenüber medienvermittelter Kommunikation in der erhöhten Glaubwürdigkeit, Flexibilität und Kontrollmöglichkeit der Wirkung durch den Kommunikator (vgl. Wiese 2005: 65). Daraus resultiert, dass der persönliche Kontakt zu potenziellen Bewerbern „am effektivsten einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung eines Arbeitgebers ausüben [kann]“ (ebd.: 65). Zu der externen, mediengestützten Employer Brand-Kommunikation sind neben internetbasierten Medienangeboten, zu denen Social Media als Betrachtungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit gerechnet werden, vor allem prinbasierte Kommunikationsmedien wie Image-Anzeigen in Zeitschriften oder Recruiting-/ bzw. Imagebroschüren zu zählen (vgl. ebd.: 65).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Instrumente interner und externer Employer Brand-Kommunikation(eigene Darstellung)
Bei der Frage nach der Art der Kommunikationsgestaltung zur Vermittlung der Arbeitgeberattraktivität wird darauf hingewiesen, dass die Zielgruppe der Nachwuchskräfte sich in der Alterskohorte der in den 1980ern und 1990ern Geborenen, die teilweise auch als Generation Y (vgl. Parment 2009: 15-16) bezeichnet werden, im Durchschnitt als technisch sehr versiert gelten (vgl. ebd.: 16 und vgl. Franken/ Franken 2011: 137), da sie mit dem Computer und dem Internet aufgewachsen sind (vgl. Jäger 2008: 59). Sie profitieren von der unternehmerischen Angewiesenheit auf Nachwuchskräfte: So haben sie die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitgebern und können Ansprüche an diese äußern (vgl. Buchhorn/ Werle 2011).
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass bei der Festlegung der EB-Ziele auf konkrete Formulierungen und Angaben zu Ausmaß und Zeitbezug zu achten ist, damit der Grad der Zielerreichung gemessen werden kann. Dabei sollten für die Erfolgskontrolle (vgl. Abb. 3) sowohl quantitative als auch qualitative Kontrollgrößen genutzt werden (vgl. Wiese 2005: 71-72).
2.2 Social Media
In diesem Abschnitt wird der Begriff Social Media vor seinem medien- und kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund erläutert. Zunächst wird der Gebrauch von Medien zu kommunikativen Zwecken als alltäglich stattfindendes soziales Handeln herausgestellt. Es wird erklärt, dass der gegenwärtige mediale und gesellschaftliche Wandlungsprozess eng an die digitalen Medien gekoppelt ist, welche die Grundlage für die Online-Kommunikation bilden. Anhand der in der aktuellen ARD/ ZDF-Online-Studie gewonnenen Ergebnisse wird die besondere Relevanz des Internets und besonders von Social Network Sites (SNS) für die Altersgruppe der Nachwuchskräfte verdeutlicht. (Kapitel 2.2.1). Sodann werden die Charakteristika des Social Web als Online-Kommunikationsraum herausgearbeitet, wobei Social Media als dessen Anwendungsplattformen definiert werden (Kapitel 2.2.2). Schließlich wird die SNS Facebook als ein besonders populäres Social Media-Angebot kurz vorgestellt (Kapitel 2.2.3).
2.2.1 Online-Kommunikation vor dem Hintergrund von Mediatisierung und Digitalisierung
Rudolf Stöber benennt als Untersuchungsbereich der Kommunikations- und Medienwissenschaften die Funktionen und Besonderheiten der menschlichen Kommunikation und des „sozialen Mediengebrauchs“ (Stöber 2008: 10). Kommunikation (abgeleitet von lat. communicare = vereinigen; (vgl. PONS o.J.a) ist als eine Form des Handelns zu verstehen, wobei das Attribut »sozial« darauf verweist, dass das Handeln stets Bezug auf Andere nimmt (vgl. Stöber 2008: 45). Da Medien Menschen miteinander in einer Kommunikationssituation vereinigen, kann auch mediengestützte Kommunikation als sozial bezeichnet werden.
Ein (Kommunikations-) Medium [12] lässt sich gemäß der lateinischen Bedeutung als etwas vermittelndes, in der Mitte liegendes (vgl. PONS o.J.b) zunächst als rein technisches Mittel verstehen, mit dessen Hilfe „kommunikative Äußerungen über die räumlichen oder (raum-)zeitlichen Grenzen direkter Kommunikation hinaus“ (Mock 2006: 191) verbreitet werden können. Über diese technologische Ausrichtung (vgl. Haas o.J.) hinaus beinhaltet der Medienbegriff ebenso die sozialen Phänomene, die an den Mediengebrauch gekoppelt sind. In diesem Sinne werden auch die „mehr oder weniger [stabilen] Verwendungsweisen bestimmter Kommunikationsmittel […] für bestimmte kommunikative Zwecke“ (Mock 2006: 194) betrachtet, die erst im Laufe ihrer Nutzung, Etablierung und Einbindung in den Alltag festgelegt werden (vgl. Gehrke/ Großmann 2010). Der alltägliche Umgang mit Medien als Resultat eines »Sich-zu-Eigen-Machens«, ausgehend von den eigenen Bedürfnissen und Motiven (Uses and Gratifications -Ansatz, UGA), wird dabei Aneignung bezeichnet (vgl. Hepp 2006: 246-247). Der UGA geht auf die Motive und Bedürfnisse ein, mit der sich Nutzer zielgerichtet einem bestimmten Medium zuwenden, weil sie sich die davon die Befriedigung ihrer Bedürfnisse versprechen (vgl. Kunczik/ Zipfel 2005: 343-344).
Friedrich Krotz beschreibt mit der Mediatisierung einen Metaprozess, der soziale, kulturelle und mediale Veränderungsprozesse umfasst, die sich aufgrund des medialen Wandels vollziehen. Diesen stellt er neben Globalisierung, Individualisierung und Ökonomisierung als die „Dimensionen des heutigen Wandels“ (vgl. Krotz 2003: 167). Er argumentiert dabei, dass sich der gesellschaftliche Alltag mit der Zunahme und der Integration neuer Medienangebote und der Art und Weise, wie Menschen die ihnen zur Verfügung stehenden Medien nutzen und aneignen, verändert (vgl. Krotz 2001: 13 und vgl. Krotz 2007: 45). Es gibt heute kaum noch einen Bereich des sozialen Alltags, der nicht von Medienkommunikation durchdrungen ist (vgl. Beck 2007: 11-15 und vgl. Danesi 2006: IX). Die Mediatisierung vollzieht sich historisch gesehen in voneinander abgrenzbaren Schüben, wobei der gegenwärtige Schub eng mit den digitalen Medien zusammenhängt. Krotz erläutert, dass diese Träger eines neuen, sogenannten sekundären Kommunikationsnetzes sind, in welchem ein Zusammenwachsen der vorher vorhandenen Einzelmedien auf Basis der Digitalisierung zu beobachten ist (vgl. Krotz 2003: 174). Da früher im primären Netz „jedes Medium [...] seine Zeit und seinen Platz im Alltag der Menschen“ (ebd.: 174) hatte, wird offenbar, dass sich mit der Verbreitung von Medien bzw. Medienkommunikation „umfassende mediale Entgrenzungen entlang […] drei Dimensionen“ (Hartmann/ Krotz 2010: 11) abzeichnen: Durch eine größere Anzahl an dauerhaft verfügbaren Medien, wie z.B. dem Internet, werden Kommunikationsprozesse intensiviert (zeitliche Ebene) und dadurch, dass unterschiedliche Orte zunehmend durch Medienkommunikation miteinander verbunden sind, nimmt die kommunikative Vernetzung auf räumlicher Ebene zu. Zudem findet Mediennutzung in immer mehr sozialen Kontexten statt (soziale Ebene) (vgl. Hepp 2009: 142).
Die Digitalisierung bezeichnet die zunehmende Dominanz digitaler Medien, die heute allgegenwärtig sind (vgl. Faulstich 2006: 166-16, 169, 171 und vgl. Schönefeld 2009: 42-43). Caroline Düvel zählt zu digitalen Medien insbesondere das Mobiltelefon sowie Formen computervermittelter Netzkommunikation wie Email, Social Media und das World Wide Web (WWW), die im besonderem Maße das Potenzial haben, „kommunikative Verbindungen zwischen Menschen zu intensivieren“ (Düvel 2009: 257). Computervermittelte Kommunikation bezeichnet „alle kommunikativen, d.h. sozialen Austauschprozesse [...], die durch einen Computer als vermittelndes technisches Medium stattfinden“ (Misoch 2006: 37). Dazu ist es notwendig, dass die einzelnen Rechner miteinander vernetzt sind, wobei das Internet als umgangssprachliches Synonym für das World Wide Web das weltweit größte Computernetzwerk ist (vgl. Beck 2006: 57). Als dezentral strukturiertes, nicht-propietäres Netzwerk (vgl. Misoch 2006: 38) stellt es nach Martin Andree einen vorläufigen Endpunkt in einer Reihe von Medienentwicklungen dar.[13] Ohne die Erfindung des Personalcomputers (PC) ist die Entwicklung[14] des WWW zu einem zivilen »Massenmedium«[15] undenkbar, da durch ihn der von großen Rechenzentren unabhängige Zugang zum Netz gewährleistet wird (vgl. Ebersbach/ Glaser/ Heigl 2011: 21-22). Die computervermittelte Kommunikation über Internet schließt als Online-Kommunikation „alle Formen der computervermittelten Kommunikation, die in anderen Computernetzwerken (insbesondere den Intranets) stattfinden, ebenso [.] wie alle Formen der computervermittelten »offline«-Kommunikation, etwa mittels CD-Rom oder DVD“ (Beck 2006: V) aus.
Betrachtet man die gesellschaftliche Diffusion des Internets aus nationaler Perspektive, so zeigt sich, dass die Verbreitung des Internets in Deutschland in den letzten Jahren sukzessive zugenommen hat (vgl. Misoch 2006: 43), obschon sich der sogenannte Digital Divide zwischen urbanen und ländlichen Gegenden, den verschiedenen Bildungsschichten, zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen abzeichnet (vgl. Misoch 2006: 43 und vgl. AGOF 2011: 5-9).[16] Im Jahr 2010 nutzten 49 Millionen Menschen ab 14 Jahren wenigstens gelegentlich das Internet, was einem Anteil von 69,4% der deutschsprachigen Erwachsenen entspricht. Zum Vergleich: 1997 waren es nur 6,5%, im Jahr 2000 dann 28,6% und 2005 57,9%. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich der Internetdurchdringung im oberen Mittelfeld (vgl. Van Eimeren/ Frees 2010: 335). Dabei kann darauf hingewiesen werden, dass das Internet besonders stark in den Alltag der jüngeren Altersgruppen eingebunden ist: 100% der 14- bis 19-Jährigen und 98,4% der 20- bis 29-Jährigen nutzen es regelmäßig. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin 89,9%. Dieser Befund kann dabei mit der Mediensozialisation der heute unter 30-Jährigen erklärt werden, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind und von daher auch als Digital Natives bezeichnet werden (vgl. Van Eimeren/ Frees 2010: 336). Allerdings macht Kai-Uwe Hugger deutlich, dass der Anspruch auf eine völlige Homogenität einer ganzen Generation angesichts der Pluralisierung und Ausdifferenzierung der »Jugend« zu weit gegriffen sei. Damit ist für diese Arbeit das Verständnis von einer hybride Jugendgeneration mit strukturellen Ähnlichkeiten in der Internetnutzung leitend (vgl. Hugger 2010: 14). Von der über alle Altersgruppen durchschnittlich online verbrachten Zeit entfällt gut die Hälfte auf Kommunikation (vgl. Van Eimeren/ Frees: 342), wobei sich eine wachsende Bedeutung von Social Network Sites für die unter 30-Jährigen abzeichnet: „Unter den 14- bis 29-Jährigen suchen [.] 79 Prozent regelmäßig »ihre« Community auf“ (Van Eimeren/ Frees 2010: 340). Dabei findet der Großteil heutiger Internetnutzung von zuhause aus statt (vgl. AGOF 2011: 11).
2.2.2 Social Media als Anwendungen des Social Web
Die Zeit ab dem Jahr 2002 wird mit dem populärem Begriff Web 2.0 verschlagwortet. Er bezieht sich auf die Zeit des erneuten Anwachsens der internetbasierten Wirtschaft, nachdem die New Economy im Jahr 2000 für beendigt erklärt wurde (vgl. Hettler 2010: 2). Der Ausdruck New Economy, oder auch Dotcom- Phase, beschreibt, dass mit dem Aufkommen des Internets neue Geschäftsmodelle herausgebildet werden konnten. In einem Boom kam es ab 1998 zu einer Vielzahl an neu gegründeten Internet-Start Up-Unternehmen, die allerdings – neben Positivbeispielen wie ebay – in Ermangelung tragfähiger Unternehmenskonzepte im Gros bereits nach kurzer Zeit Insolvenz anmelden mussten (vgl. Ebersbach/ Glaser/ Heigl 2008: 23).
Obschon der Terminus Web 2.0[17] in Analogie zur Terminologie von Softwareentwicklungen suggeriert, dass es einen „Versionssprung“ (Schmidt 2007: 24) des Internet gegeben hat, geht es tatsächlich vielmehr um die gefühlte Veränderung des Internets und wird genutzt, um dieser neuen sozialen Bewegung besonderen Nachdruck zu verleihen (vgl. Bender 2011: 145 und vgl. Ebersbach/ Glaser/ Heigl 2011: 9, 27). Die neuen sozialen Interaktionsformen sind nicht technisch determiniert (vgl. ebd.: 15), denn die meisten technischen Möglichkeiten wurden bereits im Laufe der 1990er Jahre entwickelt und standen damit schon eine Weile zur Verfügung (vgl. Münker 2010: 35, 37). Sie konnten jedoch erst mit der später erhöhten Datenübertragungsrate genutzt werden (vgl. Hettler 2010: 2-3). Der Begriff Web 2.0 ist also als unpräzise zu bezeichnen; zumal es seit jeher Anliegen des Internetbegründers Tim Berners-Lee war, die soziale Vernetzung von Menschen zu fördern. Von daher wird mit dem hier präferiertem Begriff des Social Web deutlich gekennzeichnet, dass es keine neue Ausführung des WWW gegeben hat (vgl. Walsh/ Kilian/ Hass 2011: 7) und dass sich die Art der Internetnutzung in einer evolutionären statt revolutionären Entwicklung an das ursprüngliche Ziel des Internet annähert (vgl. Gehrke/ Gräßer 2007: 34 und vgl. Hettler 2010: 11).
Das Social Web ist durch eine Neudefinition der Rolle des Internetnutzers gekennzeichnet. Es zeichnet sich insbesondere durch die zunehmende Bereitschaft zur aktiven Kommunikation und eigener Inhaltsproduktion (User Generated Content)[18] aus, wobei die Attraktivität und der Erfolg vieler Anwendungen in entscheidendem Maße auf den Beiträgen der Nutzer beruht. Dabei profitieren alle Nutzer von den sich ergebenden Effekten kollektiver Intelligenz (vgl. Hettler 2010: 6-7)[19]. Das Web zeichnet sich demnach zunehmend durch einen wachsenden Anteil an many-to-many -Kommunikation[20] aus (vgl. Walsh/ Kilian/ Hass 2011: 3), wodurch der traditionelle „one-to-many“-Kommunikationsprozess (Shih 2009: 26), in dem der Nutzer passiv Inhalte von Unternehmen, öffentlichen Institutionen, Providern oder technisch Versierten empfängt, aufgelöst wird (vgl. Schönefeld 2009: 28). Durch die Veränderung der Sender-Empfänger-Struktur in Richtung einer „reziproken Kommunikationsbeziehung“ (Shih 2009: 26) hat sich ein neues Nutzer-Selbstverständnis herausgebildet: Durch die Möglichkeiten der sogenannten »Mitmachmedien« als soziale Austauschplattformen (vgl. Hettler 2010: V) können Nutzer Kritik äußern (vgl. Fabel/ Sonnenschein 2011: 192), sich authentisch auf Basis der Erfahrungen anderer informieren und somit in zunehmenden Misstrauen gegenüber den traditionellen Massenmedien selbstagierend auftreten (vgl. Baumgartner 2007: 11).[21] Mit der Verlagerung der Inhaltsgestaltung hin zu den Nutzern haben sich auch die Rahmenbedingungen für Unternehmen verändert (vgl. Schönefeld 2009: 43).[22] Dieser Sachverhalt schlägt sich im wirtschaftlichen Kontext in dem Begriff Customer Energy (Fabel/ Sonnenschein 2011: 191) bzw. Consumer Empowerment (vgl. Arnhold 2010: 4) nieder, wobei gemäß dem Argumentationsgang dieser Arbeit als Kunden (Customer) im weitesten Sinne jegliche Anspruchsgruppen eines Unternehmens verstanden werden, also auch (potentielle) Bewerber.
Die Verbreitung von Social Media als Anwendungen, die das Social Web konstituieren, wird von verschiedenen Faktoren getrieben. Zum einen sind die Zugangsbarrieren niedriger geworden: Durch den Ausbau der technischen Infrastruktur konnten die Datenübertragungsraten gesteigert werden, wodurch der Internetzugang schneller ist (vgl. ebd.: 56). Die Kosten für die Internetnutzung durch das Angebot von Flatrates gegenüber zeitabhängiger Tarife sind zudem deutlich gesunken (vgl. Hettler 2010: 3). Zum anderen sind die intensivsten Internetnutzer, die unter 30-Jährigen, mit PC und Internetzugang aufgewachsen und durch ihre Mediensozialisation allgemein an die typischen Funktionalitäten, wie z.B. die Verlinkung von Artikeln, gewöhnt (vgl. Berge/ Buesching 2011: 22). Weiterhin trägt auch die einfache, intuitive Bedienbarkeit der Social Media-Angebote, die auch weniger technikaffinen Personen den Umgang mit Social Media erleichtert, zu dem Erfolg der Social Web-Partizipation bei (vgl. Walsh/ Kilian/ Hass 2011: 9, 13 und vgl. Berge/ Buesching 2011: 22).
[...]
[1] An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass Erfolg mehrdimensional zu sehen ist. Neben dem problemlos über Zahlen abbildbaren monetären Erfolg können auch Qualitätsverbesserungen, wie z.B. eine gesteigerte Zufriedenheit der Bewerber als (nicht-monetärer) Erfolg gewertet werden (vgl. Nagel 1997: 250).
[2] Der ressourcentheoretische Ansatz (Resource Based View) verfolgt das Ziel, strategisches Verhalten und Erfolg von Unternehmen zu erklären. Während der lange Zeit vorherrschende Market Based View unternehmerischen Erfolg auf die Marktstruktur und eine vorteilhafte Positionierung in einer attraktiven Branche zurückführt, fokussiert der Resource Based View die Innenverhältnisse eines Unternehmens. Kernaussage des Ansatzes ist dabei, dass die unterschiedliche Ressourcenausstattung von Unternehmen Erfolgsunterschiede verursacht. Mitarbeiter sind dabei den humanen Ressourcen zuzurechnen (vgl. Sammerl 2006: 121-122).
[3] Bereits in Fußnote 1 wurde verdeutlicht, dass die rein ökonomische Sicht auf den Arbeitnehmer kritisch zu hinterfragen ist. Da es in diesem Kapitel jedoch darum geht, den derzeitigen grundlegenden akademischen Stand des Employer Brandings darzustellen, wird auch das dort übliche, offenbar stark ökonomisch gefärbte Vokabular verwandt.
[4] Beim Fachkräftemangel handelt es sich nicht um ein konjunkturabhängiges Phänomen, denn es herrscht ein langfristiger Engpass an qualifizierten Arbeitskräften (vgl. Weitzel/ Eckhardt/ von Stetten/ Laumer 2011a: 6).
[5] Der Begriff War for Talents wurde 1997 von Ed Michaels, dem amerikanischen Direktor der Unternehmensberatung McKinsey, geprägt. Sinngemäß als »Kampf um die Besten« übersetzt, fasst der Terminus die bisherigen Erläuterungen zusammen: High Potentials werden in der Wissensgesellschaft als entscheidendste und gleichzeitig knappste Ressource zur Generierung von Unternehmenserfolg und Wettbewerbsvorteilen angesehen (vgl. Michaels/ Handfield-Jones/ Axelrod 2001: 1).
[6] Dieser Arbeit ist das Verständnis von Human Resources als „all of the people who currently contribute to doing the work of the organization, as well as those people who potentially could contribute in the future, and those who have contributed in the recent past“ (Jackson/ Schuler/ Werner 2009: 14) zugrunde gelegt. Zum Human Resource Management zählen Anwerben und Auswahl von Personal, Entlohnung und Leistungsmessung, Trainingsmaßnahmen etc.
[7] Die Trennung in interne und externe Effekte dient an dieser Stelle vor allem didaktischer Natur und soll dabei helfen, einen ersten Überblick zu erlangen. Es ist aber zu sagen, dass sich alle Wirkbereiche gegenseitig bedingen. Beispielsweise vermittelt ein zufriedener Arbeitnehmer ein attraktives Bild des Arbeitgebers an Außenstehende, sodass in deren Köpfen ein positives Image erzeugt wird.
[8] Als Entscheidung kann das Abwägen für oder gegen das Erstellen einer Bewerbung bzw. sogar für oder gegen die Annahme eines konkreten Job-Angebotes angesehen werden.
[9] Moderne Markenführung verlangt einen strategischen Ansatz eines kontinuierlich ausgerichteten Prozesses (vgl. Wiese 2005: 34). Zudem basiert Employer Branding auf dem identitätsorientierten Ansatz der Markenführung. Ausgangspunkt des Konzeptes ist dabei die Erkenntnis, dass erfolgreiche Marken sich durch mehr als rein rationale Verkaufsargumente und einen ansprechenden Auftritt kennzeichnen. Als wesentlicher Erfolgsfaktor einer Marke wird in Analogie zur menschlichen Persönlichkeit eine spezifische Identität angesehen. Damit drückt die Markenidentität aus, wofür die Marke stehen soll. „Sie umfasst dabei die bedeutungsvollsten und wesensprägenden Merkmale einer Marke, die sie durch die Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit dauerhaft von anderen unterscheidet“ (Wiese 2005: 35). Erst die Kontinuität der wesentlichen Identitätsmerkmale verschafft der Marke ihre Glaubwürdigkeit, was die Voraussetzung für die Entwicklung und Festigung von Vertrauen seitens der Zielgruppe bildet (vgl. Wiese 2005:34-35).
[10] Die Analyse der Mikroumwelt lässt sich anhand des Fünf-Kräfte-Modells nach Michael Porter durchführen, in dem die Rivalität der Wettbewerber untereinander, die Verhandlungsstärke der Kunden und Lieferanten sowie der Markteintritt neuer Wettbewerber und die Gefahr der Substitution des eigenen Angebotes (vgl. Vettinger 2009: 38). Die Makroumwelt kann mittels Analyse politisch-rechtlicher, makroökonomischer, sozio-kultureller, technologischer sowie ökologischer Umweltfaktoren mit der globalen Umweltanalyse durchgeführt werden (vgl. Steinmann/ Schreyögg 2000: 162).
[11] Die Markenbekanntheit stellt dabei die notwendige Bedingung für den Markenerfolg dar, weil sie dafür sorgt, dass sich Bewerber ein Image, einen wertenden Eindruck von der Employer Brand, machen können (vgl. Wiese 2005: 48-49).
[12] Unter dem Begriff Kommunikationsmedien werden Medien gefasst, die eine interpersonale Austauschsituation zwischen zweien oder mehreren Individuen ermöglichen. Sie besitzen teilweise auch Speicher- und Übertragungsfunktion und stellen somit kombinierte Medienangebote dar (vgl. Misoch 2006: 19).
[13] Martin Andree stellt die These auf, dass das Internet einen vorläufigen Endpunkt in der Medienentwicklung darstellt, da sich über das Internet sämtliche andere Medien in digitaler Form abbilden lassen (vgl. Kerres/ Nattland 2007: 37-38). Es sei allenfalls an eine flächendeckendere Implementierung und marginale Verbesserung der aktuellen „medialen Leistungsdimensionen, [die; Anm. d. Verf.] ihr strukturelles Optimum erreicht haben“ (Andree 2010: 175) zu denken.
[14] Für einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Internetexpansion vom ersten Netzwerk bis hin zum WWW empfiehlt sich die Lektüre von Abbate (2000).
[15] Wie Ryan/ Wentworth 1997: 97 betonen, kann das Internet nicht im eigentlichen Sinne als klassisches Massenmedium bezeichnet werden. Dadurch, dass es einen Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden gibt, kann gemäß der Definition von Massenkommunikation nach Maletzke („Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form von Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft) durch technische Verbreitungsmittel (Medien) indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagendem und Aufnehmenden) an ein disperses Publikum vermittelt werden“) (Maletzke 1963: 32) Social Media nicht dazu gezählt werden. In einem sozialen Netzwerk ist die maximale Empfängerschaft allerdings zumeist auf die Anzahl der registrierten Nutzer beschränkt - und damit auch nicht vollkommen öffentlich. Zudem ist die Kommunikation auf einer SNS nicht von Unidirektionalität gekennzeichnet, da die Nutzer wechselseitig in die Rollen von Sender und Empfänger schlüpfen. Da es keine übergreifende Instanz bzw. Autorität gibt, die alle Online-Informationen prüft, wird das Internet als dezentral bezeichnet.
[16] Auch weltweit zeichnet sich ein ungleich verteilter Zugang zum Internet ab, da vornehmlich die wohlhabenden Staaten Europas, die USA, Teile Asiens und Australien an das Internet großflächig angeschlossen sind (vgl. Misoch 2006: 43). Damit sind Afrika und Teile Asiens von der „digitalen Ära“ (Münker 2010: 34) ausgegrenzt.
[17] Der Begriff entstand 2004 in einer von Verleger Tim O´Reilly veranstalteten Brainstorming-Sitzung für eine neue Internetkonferenz, deren Ziel ein Austausch über die Web-Veränderungen nach Ende der New Economy war. Mit dem Begriff »Web 2.0« wurde dabei die Zeit seit deren Untergang belegt. Dale Dougherty, Vizepräsident von O´Reilly, betonte dabei, dass das Internet wichtiger denn je geworden sei und der Begriff wurde enthusiastisch aufgenommen, sodass er schnell zum Schlagwort avancierte (vgl. Ebersbach/ Glaser/ Heigl 2011: 28 und vgl. Walsh/ Kilian/ Hass 2011: 4 und vgl. Hettler 2010: 4).
[18] Ulrike Arnhold formuliert die Definition von User Generated Content (UGC) in Anlehnung an Stöckl/ Rohrmeier/ Hess 2008: 273 folgendermaßen: „special form of content which is produced independently by a user with the help of the internet for an undetermined audience without a direct profit orientation“ (Arnhold 2010: 27-28).
[19] Auch als Weisheit der Vielen bezeichnet, verweist dieser Begriff auf den Mehrwert einer Plattform, der sich aus der „größtenteils [unwillkürlichen] und [unabhängigen] Kollaboration der Nutzer“ (Hettler 2010: 6) ergibt. Alle Nutzer profitieren von dem in Gruppenprozessen akkumulierte Input (Wissen, Erfahrung) ihrer Mitmenschen, das weit über die Möglichkeiten dessen, was der Einzelne zu leisten vermag, hinausgeht. Dies wird vor allem dadurch gestützt, dass immer mehr Software gänzlich in das Web verlagert wird, wodurch das Web als Service-Plattform bezeichnet werden kann (vgl. Hettler 2010: 5).
[20] Diese Kommunikationsbeziehung zeichnet sich dadurch aus, dass viele Sender mit vielen Empfängern kommunizieren können. Die auf Social Media-Basis stattfindende many-to-many-Kommunikation findet also in einem öffentlichen Rahmen statt und wird internetbasiert dokumentiert, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgerufen werden kann. Im Vergleich zur traditionellen one-to-many -Kommunikationsbeziehung, in welcher ein Sender Inhalte an viele Empfänger übermittelt (»Einwegkommunikation«), eröffnet Social Media „Kommunikationswilligen die Möglichkeit, initiativ tätig zu werden und eigenständige Beiträge zu veröffentlichen“ (Hettler 2010: 17). Damit steigt die grundsätzliche Chance, eine Reichweite der eingestellten Beiträge zu erreichen, die jene von traditionellen Massenmedien übersteigt. Dadurch werden Inhalte sehr schnell im Netz verbreitet, sodass ein schneller Aufbau von Informations- und Beziehungsnetzwerken möglich ist (vgl. Hettler 2010: 16-21).
[21] Im allgemeinen kann auch der von Charlene Li und Josh Bernoff (2009) geprägte Begriff des Groundswell angeführt werden, welcher den sozialen Trend bezeichnet, „bei dem die Leute Technologien benutzen, um das, was sie brauchen, voneinander zu bekommen statt von traditionellen Institutionen wie Unternehmen“ (Li/ Bernoff 2009: 16).
[22] In Folge der Möglichkeiten des Social Web haben sich die Produkt-Hoheitsverhältnisse des Anbieters hin zu seinen Kunden verlagert. So wird im Portal Holiday Check der „Marketingmacht [..] mit der alleinigen Beschreibungs- und Darstellungsgewalt […] eine koordinierte Macht des Verbrauchers in Form von Bewertungsportalen und www.guenstiger.de durch erhöhte Preistransparenz eine Auswirkung auf die vormaligen Preis-Hoheitsverhältnisse von Unternehmen. Zudem hat sich auch die Kommunikationshoheit hin zu den Nutzern verlagert: Anhand von Bewertungsportalen wie z.B. für Arbeitgeber (www.kununu.de) findet der Transport von Bildern nicht mehr ausschließlich durch das Unternehmen statt, wodurch sich viel leichter feststellen lässt, ob die transportierten Werte von der durch die Nutzer empfundenden Wirklichkeit übereinstimmen (vgl. Schönefeld 2009: 35-37).
Details
- Titel
- Employer Branding: Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Social Media
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 57
- Katalognummer
- V297981
- ISBN (Buch)
- 9783958200470
- ISBN (PDF)
- 9783958205475
- Dateigröße
- 7550 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- HR Online-Kommunikation Facebook Arbeitgebermarke Humankapital Wettbewerb Stellenmarkt
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2011, Employer Branding: Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Social Media, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297981
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.