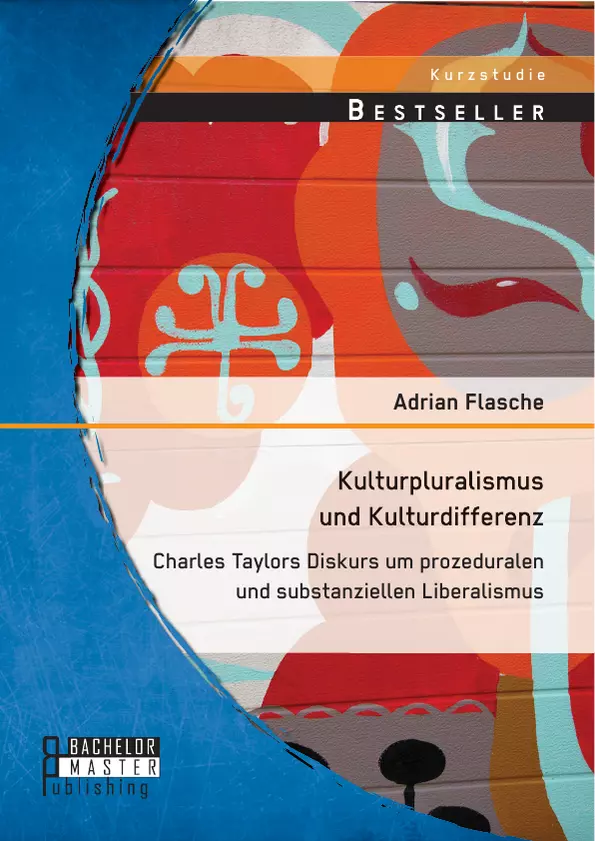Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos
Kulturpluralismus und Kulturdifferenz: Charles Taylors Diskurs um prozeduralen und substanziellen Liberalismus
Studienarbeit, 1995, 30 Seiten
Kategorie
Studienarbeit
Institution / Hochschule
Note
1
Leseprobe
I. Einleitung
Die Menschheit ist – obwohl sie biologisch gesehen eine Spezies darstellt – keine homogene Weltgemeinschaft, sondern seit Beginn ihrer Existenz vor ca. 40.000 Jahren hochgradig heterogen und fragmentiert – zum einen natürlich durch verschiedene Lebensräume, zum anderen aber besonders durch verschiedene Sprachen, verschiedene Verhaltens-, Denk- und Glaubensweisen und daraus resultierenden Gesellschaftsformen (prägt die Gesellschaft den Menschen oder der Mensch die Gesellschaftsform?); kurz: durch einen Pluralismus an Kulturen. Problematisch an dieser Kulturenvielfalt ist die – vermeintliche? – Unvereinbarkeit jener Daseinsformen, die zum Teil konträr zueinander, ja sogar feindselig gegeneinander stehen. Ein Blick in die Geschichte zurück zeigt, dass verschiedene Kulturen sich stets voneinander abgrenzten, indem sie ihre jeweilige Lebensform anfangs durch ein Territorium, später durch einen Nationalstaat von anderen isolierten. Nichtsdestoweniger versuchte – fast – jede Kultur, jeder Nationalstaat, seine Lebensform expandieren zu lassen, sprich: den andersartigen Kulturen seine vermeintlich bessere aufzuzwingen.
Es wurde und wird die Frage gestellt, welche von diesen Kulturen denn die wahre, die vernünftigste, die zu bevorzugende für die gesamte Menschheit sei. Spätestens seit der industriellen Revolution vor knapp 200 Jahren hat die sogenannte westliche Welt – Europa und Nordamerika – die „Führung“ der Erde übernommen. Es könnten aber auch schon die mittelalterliche Christianisierung mittels Kreuzzügen, die Konquistadorenzeit und die Ära „neuer“ Erdteilentdeckungen als Hegemonie angesehen werden. Jedenfalls hat die westliche Welt das Selbstverständnis, mit ihrer liberalen, demokratischen Gesellschaftsform und ihrer freien oder sozialen (?) – sozialeren – Marktwirtschaft die geeigneteste und ideale Gesellschaftsform für die ganze Menschheit zu sein. Andere Kulturen mit jeweils differenten Lebensformen erheben diesen Anspruch aber ebenso – z.B. die islamische Welt, der Kommunismus mit seinen verschiedenen Ausgestaltungen oder faschistische, monarchistische und oligarchische Staaten.
Schließlich besteht das Problem der verschiedenen Kulturen nicht nur international, sondern auch innerhalb e i n e r Gesellschaft, in der Binnenstruktur, wo sich die Konflikte mit der Kulturdifferenz besonders herauskristallisieren. In den meisten bi- und multikulturellen Gesellschaften gibt es eine Mehrheit, die dementsprechend über wirtschaftliche und politische Macht verfügt, sowie eine oder mehrere ethnische Minderheiten. Häufig werden diesen Minderheiten Rechte vorenthalten, werden sie als Bürger zweiter Klasse behandelt. Diese Unterdrückung beginnt mit Geringschätzung und kann über massive Diskriminierung bis zum Schlimmsten, dem Völkermord, führen.
Einerseits streben kulturelle Minoritäten die Gleichberechtigung an, verlangen also dieselben Rechte, die der Majorität eigen sind. Andererseits wollen ethnische Minderheitskulturen zwar gleichberechtigt werden, Gleichwertigkeit erfahren, jedoch nicht von der Mehrheit assimiliert – und somit wiederum diskriminiert – werden. Das Ziel von ethnischen Minderheiten ist das Recht, die Freiheit zu erhalten, mit der sie ihre ureigene Kultur erhalten und entfalten können – ebenso, wie die Mehrheit ihre Kultur frei entfalten kann. Als Beispiel hierfür kann der Konflikt zwischen Kurden und Türken in der Türkei angeführt werden: Das kurdische Volk möchte einerseits gleichberechtigt werden, aber nicht zu Türken homogenisiert werden, sondern das Recht erhalten, die kurdische Kultur frei leben und entfalten zu können. Sie beanspruchen genau dieselbe Freiheit, kraft deren das türkische Volk sich frei entfalten und erhalten kann. Das ist die Forderung nach gleichwertiger Achtung für ihre Kultur.
Somit kämpfen ethnische Minderheiten nicht ausschließlich für Gleichberechtigung, sondern für die Akzeptanz ihrer Andersartigkeit, für ihr Recht auf Verschiedenheit.
Schließlich gibt es nicht nur Differenzen zwischen verschiedenen Völkern, sondern auch innerhalb eines Volkes, einer Kultur: innergesellschaftlich werden ebenfalls Gruppen oder Teile der Bevölkerung geschlechtsspezifisch oder wegen ihrer sexuellen Vorlieben – subtil oder offen – unterdrückt und fordern Gleichberechtigung bzw. die Achtung für ihre eigene Kultur.
Im Idealfall sollten alle Kulturen in einem multi- oder bikulturellen Staat gleichwertig und gleichberechtigt sowie friedlich und frei neben- und miteinander leben.
Gesteht man nun aber einer ethnischen Minderheit weitreichende Freiheiten zu, geht damit meist eine Einschränkung der anderen Volksgruppe(n) einher. Wie weit kann und sollte die Majorität ihre Rechte zugunsten einer Minorität einschränken (lassen)? Und häufig wollen auch ethnische Minderheiten gar keine Koexistenz; vielmehr verlangen sie einen eigenen, autonomen Staat – was wiederum zur Spaltung des bisherigen Staates und somit u.a. zu neuen Minderheitsproblemen führt.
Die Zahl solcher weltweiter ethnischer Konflikte und Kriege ist lang: der Nordirland-Konflikt; der Krieg in ex-Jugoslawien; Tschetschenien – Rußland; Spanien – Baskenland; Indonesien – Ost-Timor; Russland – ehemalige sowjetische Unionsrepubliken; Nagorny-Karabach; Italien – Südtirol; Sri-Lanka – Tamilen; Indien – Kashmir; China – Tibet; Marokko – Tuareks; Tutsis uns Hutus in Burundi/Ruanda; Australien – Aborigines; Südafrika; Birma – Karen; Mexiko – Chiapas; Flamen – Valonen… Hier ist die Aufzählung ganz sicher noch nicht zu Ende, sie kann um etliche Konflikte erweitert werden. Allerdings muß bei dieser Aufzählung bedacht werden, dass die Konflikte nicht gänzlich unter denselben Vorzeichen und Ausgangspositionen stattfinden, sondern innerhalb verschiedener Kontexte - und deshalb auch differenziert voneinander betrachtet werden müssen.
Bedacht werden muß auch, daß ethnische Minderheiten in einigen Fällen Kulturen durchsetzen wollen, die den demokratischen Staat hochgradig unterlaufen. Wie soll in solch einer Situation - die so abwegig nicht ist - mit einer ethnischen Minderheit umgegangen werden, die eine traditionell antidemokratische und menschenrechtsverachtende Kulturform hat? Besonders uns in den westlichen Industrieländern muß die Frage beschäftigen: Welche Urteilswege stehen uns überhaupt für andersartige Kulturen offen? Sollen und dürfen wir unsere Ideale von Toleranz, Freiheit, Demokratie und Menschenrechten der ganzen Welt mit ihren zahlreichen antidemokratischen Gesellschaften aufzwingen? Haben wir das Recht, auf - vermeintlich - rückständige, atavistische Kulturen mißliebig zu schauen? Oder sollen wir fremde Kulturen, sind sie auch menschenrechtsfeindlich, akzeptieren als eben andere, "exotische" Kulturen mit ureigenem Reiz, als die Schönheit der Andersartigkeit? Und dürfen die westlichen Demokratien kommunizieren und Handel betreiben mit Ländern, welche in ihrer Gesellschaft unsere hehren Werte mit Füßen treten?
Schließlich lautet die Frage, wie die westlichen Demokratien mit der menschlichen Lebensform, die sich in eine Vielzahl von Daseinsformen differenziert hat, umgehen, wie wir ihr begegnen wollen - um eine Welt zu schaffen, in der verschiedenste Lebensweisen friedlich miteinander koexistieren, ohne einander zu diskriminieren.
In diese multikulturelle Debatte, die häufig sehr polemisch und undifferenziert geführt wird, hat u.a. der Kanadier Charles Taylor mit seinem Essay Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung - 1992 in der Princeton University Press erschienen - versucht, Nüchternheit und Differenziertheit in die hitzige Auseinandersetzung zu bringen. Darüber hinaus versucht er, die Frage des multikulturellen Kontextes konstruktiv zu beantworten.
II. Darstellung der Argumentation von Charles Taylor
Charles Taylor - Professor für Philosophie und Politwissenschaften an der Mc Gill University in Montreal sowie aktiver Politiker in Quebec für die New Democratic Party - versucht in seinem 1992 erschienenen Buch mit dem Originaltitel Multiculturalism and `The Politics of Recognition` die Problematik von der Vielfältigkeit menschlicher Kulturen aufzuzeigen. Seine Ausgangspunkte sind hierbei zum einen die Pluralität der differenzierten menschlichen Daseinsformen, zum anderen die Identität des Menschen.
1. Identität und Anerkennung
Taylors` Ansatz stellt einen engen Zusammenhang zwischen der Identität und deren Anerkennung her. Den Begriff "Anerkennung" (S.13;Z.2f) verwendet er im Sinne von Wertschätzung und Achtung, mit "Identität" (S.13;Z.17) ist das Selbstverständnis des Menschen gemeint. Taylor stellt nun die These auf, daß die Identität eines jeden Menschen zu einem großen Teil von der Anerkennung anderer abhängt und geprägt wird - und demzufolge auch von der verweigerten Anerkennung, der "Nicht-Anerkennung" (S.13;Z.18f). So kann die Verkennung einem Menschen, einer Gruppe von Menschen als auch einem ganzen Volk immensen Schaden zufügen. Denn Taylor weist auf die suggerierende Wirkung von Nichtachtung hin: die Erzeugung von Selbstverachtung in dem nicht-anerkannten Menschen. Durch Nichtanerkennung wird der verkannten Person oder Minderheit ein vermeintlicher Spiegel vorgehalten, in dem ihre eigene, angeblich minderwertige Existenz projiziert wird. Schließlich nimmt der nach Anerkennung Strebende – laut Taylor – dieses falsche Spiegelbild der Verachtung zu seiner Identität auf. Diese suggerierte Selbstverachtung "deformiert" (S:13;Z.21) letztlich die Identität der Minderheit, und führt schließlich zu einer "destruktiven Identität" (S.14;Z.21). Taylor bezeichnet die Verkennung als Waffe der Majorität zur Unterdrückung von Minderheiten, indem sie Selbstverachtung produziert und damit die Minderheit durch Selbstzweifel und -haß zersetzt und ihr ihre vermeintliche Unfähigkeit und Abhängigkeit "beweist". Als Beispiele führt Taylor bedrohte ethnische Minoritäten und Frauen – die natürlich keine Minderheit sind! – und trotzdem unterdrückt werden – an. Viele Frauen haben sich das patriarchalische Minderwertigkeitsbild angeeignet und sich danach gerichtet.
Aus diesen Gründen ist für Taylor die Anerkennung ein menschliches Grundbedürfnis, denn sie spielt eine wesentliche Rolle in der Entwicklung zu einer selbstbewußten und mündigen Identität des Menschen – und auch bei vielen in Gruppen und Völkern zusammengefaßten Menschen.
2. Die Identitätsentwicklung im historischen Rückblick
Taylor merkt an, daß der Gebrauch und das Verständnis der Begriffe `Identität` und `Anerkennung` historisch gesehen noch recht jung sind. In der Geschichte hat es vor allem zwei "tiefgreifende Wandlungen" (S.27;Z.18) gegeben, die die Identität und die Anerkennung erst ermöglicht haben. Dieser Wandel im menschlichen Selbstverständnis ging einher mit dem Übergang von autoritär-hierarchischen zu demokratischen Gesellschaften. Der erste Wandel bestand in dem Austausch der elitären Ehre durch die egalitäre Würde. Taylor erläutert, daß in hierarchischen Gesellschaften dem Menschen als Anerkennung Ehre erwiesen wurde - wenigen einzelnen Menschen. Denn die Ehrerbietung beruht ja auf "Bevorzugung und Besserstellen" (S.15/16;Z.32/1), auf das Exponieren von Menschen gegenüber anderen Menschen. Hierdurch wurde eine Ungleichheit geschaffen und festgeschrieben. Die demokratischen Gesellschaften hingegen setzten an die Stelle der Ehre die gleichheitliche Würde, die nun j e d e m Menschen zuteil wurde: "Verdiente" vorher nur ein "besonderer" Mensch Ehre, so hatte jetzt jeder Mensch ein festgeschriebenes Recht auf Achtung seiner Würde - und dadurch auf Anerkennung. Die Einführung des Würde - Prinzips ermöglichte die Gleichstellung aller Menschen in einem demokratischen System, die gleiche Anerkennung für alle. Diese Ansicht von Gleichberechtigung und Anerkennung mit Hilfe der universalistischen Würde dauert bis heute - in demokratischen Staaten - an. Für den Autor ist diese Errungenschaft, diese neue Einsicht der erste entscheidende Wandel gewesen.
Im Zuge der Aufklärung - also im 18.Jahrhundert - wurde dieser erste Wandel durch einen zweiten vertieft und konkretisiert. Taylor nennt den zweiten Wandel die "individualisierte Identität" (S.17;Z.2): jedem Menschen wurde eine ihm eigene, unverwechselbare Identität zugesprochen, welche aus seinem Selbst entspringt. Hierin liegt eine entscheidende Veränderung: Hat das Individuum sein Dasein - und seine Moral - früher ausschließlich über Gott bezogen und definiert, so wird die individualisierte Identität jetzt durch eine Besinnung des Menschen auf sich selbst, auf seine innere moralische Stimme gewonnen. Durch den Bezug auf sein persönliches Gewissen hat der Mensch seine Identität individualisiert, d.h. einmalig und von jedem anderen Individuum unterscheidbar gemacht. Aus dem einzelnen Menschen wurde eine individuelle Persönlichkeit. Taylor nennt diesen Besinnungswandel den "...Teil der tiefgreifenden subjektiven Wendung [ ... ], [die] neue( ) Form von Innerlichkeit, in der wir uns selbst plötzlich als Wesen mit inneren Tiefen wahrnehmen" (S.18;Z.9ff). Jene individualisierte Identität, mit der der Mensch auf sein eigenes moralisches Empfinden von Gut und Böse zurückgreift, nennt der Autor auch "Authentizität" (S.17;Z.7). Die Authentizität enthält die Treue zu sich selbst: Jeder Einzelne soll und muß das Leben leben, welches ihn durch seine ureigene Art ermöglicht wird - also nicht die Nachahmung des Lebens anderer, sondern das aufrichtige Existieren mit den Möglichkeiten, die das eigene Wesen zur Verfügung stellt - und die das Wesen zur Verwirklichung drängt. Rousseau war der erste, der auf die Authentizität hinwies und sie als das "Gefühl des Daseins" (S.20;Z.4f) beschrieb. Weiterentwickelt wurde die Erkenntnis von der Authentizität dann von Herder. Taylor schließlich betont, daß der Mensch aufgrund dieses "Prinzip[s] der Originalität" (S.20;Z.2) gar nicht die Möglichkeit hat, das Leben anderer Menschen zu bestreiten. Durch die Befolgung der Authentizität definiert sich die Person und entwickelt daraus ihre Selbstverwirklichung.
3. Identitätsbildung durch Dialog
Mit der Einbringung vom "dialogischen Charakter menschlicher Existenz" (S.21;Z.24f) kommt Taylor wieder auf die anfangs dargestellte Signifikanz der Anerkennung bezüglich der Identität zurück : Denn der Mensch bestimmt seine Identität nicht ausschließlich über Selbstgespräche und Nachsinnen, sondern vor allem durch den Dialog mit seinen Mitmenschen - den sogenannten signifikanten Anderen (S.22;Z.6). So erlernt er alle sprachlichen Ebenen - Sprache, Kunst, Gestik, Liebe - nicht aus sich selbst heraus, sondern durch den Austausch mit anderen. Viele Dinge lassen sich Taylors` These zufolge überhaupt nicht monologisch, also per Selbstgespräch, erfahren, sondern lediglich in Interaktion mit anderen Menschen. Schlußfolgerung dessen ist, daß die Authentizität sowohl aus dem Monolog als auch besonders aus dem Dialog gebildet wird. Hierbei unterscheidet der Autor die Interaktion in einen offenen - also verbalen - sowie in einen inneren - die Auseinandersetzung des einzelnen mit den Mitmenschen nur in Gedanken, also nonverbalen - Dialog. Aus dieser Zweiteilung ergibt sich dementsprechend eine äußere als auch eine innere Identität: Die schon seit langen Zeiten anerkannte Identität durch die soziale Stellung sowie die meistens vernachlässigte innere Identität, die aus dem Selbst, aus der Tiefe der Person heraus entsteht. So wird die Identität in hierarchischen Gesellschaften ausschließlich durch die soziale Stellung - Beruf, Stand - des Menschen definiert, wohingegen die Identität in Demokratien zusätzlich, neben der sozialen Position, eben besonders von der Authentizität des einzelnen her bestimmt wird. Taylor sieht in der Anerkennung der persönlichen Identität eine immense Signifikanz, die erst in der Moderne erkannt wurde. Für den Autor sind folgende zwei Ebenen, von denen die Entwicklung und die Anerkennung der Authentizität abhängig ist, entscheidend: zum einen die "Ebene der persönlichen Beziehungen" (S.25;Z.32), zum anderen besonders die "gesellschaftliche[ ] Ebene" (S.26;Z.11). Die Ebene der persönlichen Beziehungen, besonders die der Liebesbeziehungen, definiert Taylor als den "zentrale[n] Ort der Selbstentdeckung und Selbstbestätigung" (S.26;Z.5f).
4. Die Politik der gleichheitlichen Anerkennung und die Politik der Differenz
Schließlich geht es dem Autor aber um die Anerkennung der Authentizität auf der gesellschaftlichen Ebene. Hier gibt es ebenfalls zwei verschiedene Ansätze zu unterscheiden: die "Politik der gleichheitlichen Anerkennung" (S.26;Z.13f) sowie die "Politik der Differenz" (S.28;Z.19f). Beide Ansätze haben ihre Wurzeln in den bereits erwähnten tiefgreifenden Wandelungen. So ist die Politik der gleichheitlichen Anerkennung aus dem ersten Wandel - dem Schritt von der Ehre zur Würde - entstanden. Allen Bürgern einer Republik wird die gleiche Würde zugesprochen, werden dieselben Rechte anerkannt, und die bisherige Klassen - oder Ständegesellschaft wird zugunsten einer universalen Gleichberechtigung aufgehoben. Taylor bezeichnet diesen Ansatz auch als "Politik des Universalismus" (S.27;Z.20).
Der zweite Ansatz, die Politik der Differenz, hingegen ist vor allem aus dem zweiten historischen Wandel - der Entwicklung der individualisierten Identität - entsprungen. Dieser Ansatz stellt das Individuum - und besonders dessen Anerkennung - eindeutig in den Vordergrund. Zwar haben beide Ansätze Gemeinsamkeiten - z.B. hat auch die Politik der Differenz einen universalistischen Ausgangspunkt -, doch letztendlich geht Taylors` Ansicht nach die Anerkennung der Differenzpolitik entschieden weiter als die der Gleichheitspolitik. So deutet der Autor auf die Anschuldigung der Differenzpolitiker hin, wonach die Gleichheitspolitik besondere Minderheiten und Individuen schlichtweg der Majorität angleicht, was einem Verrat an der Authentizität gleichkomme. Der Hauptunterschied beider Ansätze liegt in der unterschiedlichen Auslegung der "Nicht - Diskriminierung" (S.30;Z.9). Demnach legt die Gleichheitspolitik Antidiskriminierung als sogenannte Differenzblindheit (S.30;Z.30f) aus - d.h. dieser Ansatz stellt sich zugunsten der universalen Gleichwertigkeit den Differenzen zwischen einzelnen "blind" -, während die Differenzpolitik Antidiskriminierung neu interpretiert, indem sie die Unterschiede einzelner Bürger gerade zum Ausgangspunkt ihrer Verfahrensweise macht. Als Beispiel für praktizierte Differenzpolitik nennt Taylor die Bevorteilung von bislang benachteiligten Personen, Gruppen sowie ethnischen Minderheiten in einer Gesellschaft - z.B. die Quotenregelung für Frauen oder den Studienplatzvorzug für Studenten ethnischer Minoritäten -, worin er eine "umgekehrte Diskriminierung" (S.30;Z.31f) sieht.
Taylor weist auch auf die unterschiedlichen Wertvorstellungen der beiden Politikformen hin. So beruft sich die Gleichheitspolitik vor allem auf den von Kant geprägten Würdebegriff, wonach das Achtenswerte des Menschen in seiner Fähigkeit zum vernünftigen Handeln liegt. Diese kantianische Einsicht bezeichnet Taylor als ein "universelles menschliches Potential" (S.32;Z.10f), als ein Gut, über das der Mensch a priori verfügt. Der Autor vergißt nicht zu erwähnen, daß dieser Würdebegriff auch auf Menschen ausgedehnt wird, die über jenes Vernunftpotential – zu mindestens vordergründig - nicht verfügen können: geistig Behinderte und Komaerleidende.
Wie bereits erwähnt, beruft sich auch die Differenzpolitik auf universales Potential, und zwar auf das für jeden Menschen verfügbare Potential von individueller und kultureller Identität. Schließlich kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu: die Forderung, daß allen verschiedenen Kulturen derselbe Respekt entgegengebracht werden muß, unabhängig von ihrer jeweiligen Entwicklung und Ausprägung. Laut Taylor besteht der Konflikt beider Politikformen in den Gegensätzen, einerseits die Konzentration auf Gleiches, andererseits das Augenmerk auf das Besondere und Verschiedene zu favorisieren. Vor allem die Differenzpolitik wirft der Gleichheitspolitik Homogenisierung und Assimilation vor - besonders aber, daß die Differenzblindheit gar kein - wie vorgegeben - neutrales Prinzip sei. Denn schließlich sei der Liberalismus (= Gleichheitspolitik) keine neutrale, sondern eine westliche und christliche Kultur - und breite sich somit hegemonial auf nichtliberale und nichtwestliche Kulturen diskriminierend aus.
[...]
Details
- Titel
- Kulturpluralismus und Kulturdifferenz: Charles Taylors Diskurs um prozeduralen und substanziellen Liberalismus
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 1995
- Seiten
- 30
- Katalognummer
- V297930
- ISBN (Buch)
- 9783958200104
- ISBN (PDF)
- 9783958205109
- Dateigröße
- 6483 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Identität Differenz Politik Universalismus Multikulturalismus
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 1995, Kulturpluralismus und Kulturdifferenz: Charles Taylors Diskurs um prozeduralen und substanziellen Liberalismus, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297930
- Angelegt am
- 29.4.2015
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.