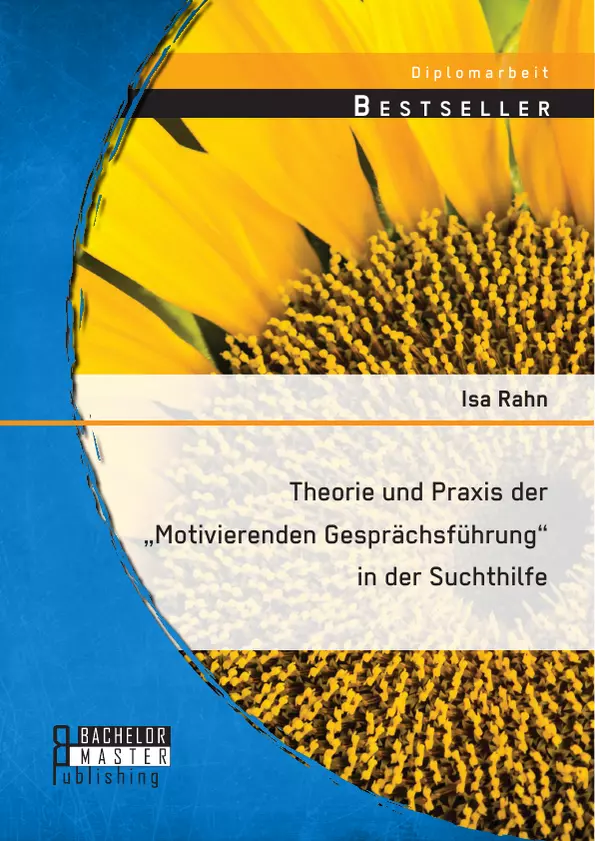Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos
Theorie und Praxis der „Motivierenden Gesprächsführung“ in der Suchthilfe
Diplomarbeit, 2007, 72 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
1.3 Theorie der psychologischen Reaktanz
Die Theorie der psychologischen Reaktanz nach Brehm postuliert einen "Reaktanz"[1]genannten motivationalen Zustand, in den ein Mensch gerät, wenn sein Entscheidungsspielraum in irgendeiner Weise eingeengt oder mit Einengung bedroht wird. Erlebt ein Mensch eine Bedrohung oder tatsächliche Einschränkung bisheriger Freiheitsräume, so wird er mehr oder weniger Energie darauf verwenden, seine Freiheit[2]wieder herzustellen bzw. die Bedrohung seiner Freiheit abzuwenden. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der betroffene Mensch das Gefühl hat, in der fraglichen Sache überhaupt entscheiden zu können und zu wollen. Die Stärke der Reaktanz hängt ab von:
- der Wichtigkeit der eingeengten Freiheit
- dem Umfang des (subjektiven) Freiheitsverlustes
- der Stärke der Einengung (vgl. Dickenberger 2006, S. 96 f.).
Reaktanz zeigt sich in (mindestens) einem der folgenden Effekte:
➙ Die Person, deren Freiheit bedroht ist (etwa durch ein Verbot), tut genau das, was sie nicht tun soll. (direkte Wiederherstellung der Freiheit)
➙ Die Person demonstriert ihre Freiheit, indem sie ein anderes, aber vergleichbares Verhalten zeigt oder indem sie einer nächsten Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten nicht nachkommt. (indirekte Wiederherstellung der Freiheit)
➙ Die Person greift diejenigen, die ihre Freiheit bedrohen, körperlich oder psychisch an. Auch empfundene Wut als Möglichkeit der Erregungsabfuhr ist Effekt von Reaktanz. (Aggressionen)
➙ Die Person findet genau die Alternative attraktiv, die ihr genommen werden soll und entwickelt zunehmend mehr das Gefühl, selbst entscheiden zu wollen und zu können (Attraktivitätsveränderung) (vgl. Dickenberger 2006, S. 98).
Wenn die Freiheitseinengung von außen vermindert oder abgebaut wird, sinkt die Stärke der Reaktanz. Dieses wird erreicht, indem eine andere (als die einengende) Person bzw. auch die einengende Person (oder auch Instanz), der Person, die sich in ihrer Freiheit bedroht fühlt, vorher ausgeschlossene Alternativen (wieder) zur Verfügung stellt (vgl. Dickenberger 2006, S. 99). In Beratungs- und Therapieprozessen in der Suchthilfe tritt wie oben beschriebene Reaktanz (oder mit dem üblichen Begriff Widerstand) häufig auf. Ursachen solchen Verhaltens u. a. der Wahrnehmung des Klienten von Freiheitseinschränkung zuzuschreiben, wird plausibel angesichts der Tatsache, dass nur ein geringer Anteil der Klienten ohne äußeren sozialen Druck eine Beratung/Behandlung beginnt und in Vorwegnahme des Prozesses kaum Alternativen und Entscheidungsmöglichkeiten erwartet. Ebenso denkbar ist auch die hohe Nichtantrittsquote eines Teils der Klienten in stationäre Drogentherapien, die mit einer (angekündigten) zeitlich begrenzten starken Einschränkung persönlicher Entscheidungsfreiheit (die in der Vorstellung sehr bedrohlich erscheinen kann) einhergehen, mit dieser Theorie in Verbindung zu sehen. Hier ist häufig eine hohe Änderungs- und Behandlungsmotivation erkennbar, aber diese Hilfeform ist dann nicht akzeptabel.
Ob ein Klient angesichts der Konfrontation mit für ihn bedrohlich wahrgenommenen Informationen kognitive Dissonanz erlebt oder Reaktanz entwickelt ist abhängig von der Attribution (Ursachenzuschreibung), z. B. kann die Aussage eines Arztes: „Sie sind schwer alkoholabhängig und müssen sofort aufhören Alkohol zu trinken!“ einerseits bei internaler Attribution eher eine Dissonanzreduktion durch die bekannten Möglichkeiten (neue Kognitionen, Herunterstufung der Relevanz der dissonanten Kognitionen oder Heraufsetzen der Relevanz der konsonanten Kognitionen) angestrebt werden, bei externaler Attribution wird eher Reaktanz mit dem Ziel der Freiheitswiederherstellung mit o. g. Effekten auftreten.
Völlig fehlende Reaktanzreaktionen bei freiheitseinschränkenden Interventionen sind eher ein Zeichen für Apathie im Sinne der Theorie der erlernten Hilflosigkeit[3]und weniger Zeichen für Veränderungsmotivation. In Zusammenschau dieser entgegengesetzten Reaktionen besteht die Annahme, dass Freiheitseinschränkung (auch im Sinne von fehlender Kontrollerwartung) von geringem Ausmaß und kurzer Dauer zu Reaktanzreaktionen und begleitendem Ärger führt; bei länger andauernder Freiheitseinschränkung und bei Aufgabe von Kontrollerwartungen werden Reaktanzreaktionen eher geringer und können bis hin zum gänzlichen Motivationsverlust führen und damit in Hilflosigkeit übergehen (vgl. Fritsche, Jonas und Frey 2006, S. 90).
Miller und Rollnick beziehen die Theorie in ihr Ambivalenzkonzept als Erklärung für die von ihnen genannten „paradoxen Reaktionen“ mit ein: trotz des Wissens und Wahrnehmens von erheblichen Nachteilen eines Verhaltens (z. B. gesundheitlicher Störungen) wird bei erheblichem Druck von außen und damit empfundener Freiheitseinschränkung das Verhalten fortgesetzt bzw. noch verstärkt (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 36 ff.). Für den Beratungs- bzw. Therapieprozess wird dementsprechend angenommen, dass so gemeinter Widerstand auch Folge von unangemessenen Interventionen des Beraters/Therapeuten ist. Werden vor allem die scheinbar so augenscheinlichen Nachteile des Klientenverhaltens vermittelt mit der scheinbar ebenso logischen Konsequenz einer Forderung der Änderung, wird der Klient eher mit den Vorteilen des Status quo argumentieren. Der „Vorteil“ dieser Reaktionen ist, dass sie für den Berater/Therapeuten wahrnehmbare Achtungszeichen sind und weitere Interventionen danach ausgerichtet werden können.
1.4 Selbstwirksamkeitstheorie
Selbstwirksamkeit ist nach Albert Bandura die Erwartung bzw. die Überzeugung, ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können bzw. eine bestimmte Situation bewältigen zu können. Selbstwirksamkeit (auch Selbstwirksamkeitserwartung, Kompetenzerwartung) hat sich als bedeutsamer Faktor in verschiedenen Theorien zur Erklärung von Verhalten und Verhaltensänderungen erwiesen. Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit ist ursprünglich Bestandteil der sozial-kognitiven Theorie von Bandura, deren Ziel es ist, "...menschliches Verhalten unter der Annahme einer ständigen Wechselwirkung zwischen kognitiven Determinanten, Verhaltensdeterminanten und Umweltdeterminanten zu erklären" (Bandura 1979, S. 10). Nach Bandura ist nicht die tatsächliche Kompetenz entscheidend, ob Personen ein Verhalten ausüben oder nicht, sondern die Überzeugung der Kompetenz. Das heißt, wer nicht überzeugt ist, z. B. ein problematisches Verhalten ändern und ein anderes Verhalten zeigen zu können, obwohl er überzeugt ist, ein ernsthaftes Problem zu haben und klare Einsicht in Änderungsnotwendigkeiten zeigt, wird erst gar keinen Versuch unternehmen. Die Selbstwirksamkeit wird von vier verschiedenen Quellen bestimmt:
- direkte Erfahrung, z. B. erfolgreiches Meistern einer Anforderungssituation in der Vergangenheit führt zur Verstärkung, Misserfolg zur Schwächung der Selbstwirksamkeit
- indirekte, auch stellvertretende Erfahrung, z. B. erfolgreiches Meistern einer Anforderungssituation durch eine andere, möglichst ähnliche Person (Modellbeobachtung)
- symbolische Erfahrung, z. B. Zuspruch von vertrauenswürdigen Anderen (soziale Unterstützung)
- Ausmaß emotionaler Erregung, z. B. ein Zuviel oder Zuwenig von emotionaler Erregung ist nicht leistungsfördernd (vgl. Stalder 1985, S. 244 ff).
Zwischen Selbstwirksamkeit und Verhalten besteht eine wechselseitige Abhängigkeit: Personen entwickeln Ziele oder Standards als Grundlage für ihre Handlungen. Es werden verschiedene Handlungsalternativen in Betracht gezogen und eine Entscheidung für das konkrete Verhalten mit Blick auf die erwarteten Ergebnisse und die wahrgenommene Selbstwirksamkeit getroffen. Nach Ausführung der Handlung wird das Ergebnis anhand äußerer sozialer und innerer Auswertung überprüft. Wenn die Auswertung positiv ausfällt, werden entweder die Anstrengungen vermindert oder für künftige Handlungen höhere Standards gesetzt. Bei negativer Bewertung (Misserfolg, Versagen) entscheiden der Wert des Ergebnisses und die Selbstwirksamkeit bei früheren Bemühungen über Aufgabe oder neuen Versuch (vgl. Pervin 2000, S. 393).
In der „Motivierenden Gesprächsführung“ ist die Förderung der Selbstwirksamkeit eines der Interventionsprinzipien, welches mit bestimmten Methoden zur Förderung von Änderungszuversicht umgesetzt wird. Oben genannte Quellen werden systematisch erkundet und gestärkt, z. B. durch Erfragen und Verstärken vergangener Erfolge, dem Erforschen von Quellen sozialer Unterstützung, dem Zuspruch bzw. der Veränderung zutrauenden Haltung des Beraters und nicht zuletzt in einer ruhigen, förderlichen Atmosphäre (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 155 f).
Auch im Zusammenhang mit der für Veränderung notwendigen Selbstwirksamkeit ist noch einmal das in der Beratung und Therapie bei Suchtverhalten häufig auftretende Phänomen der erlernten Hilflosigkeit zu sehen. Miller und Rollnick bezeichnen diesen Zustand bei Klienten als fehlende Zuversicht, als Gefühl, dass eine Veränderung nicht erreichbar ist, obwohl möglicherweise die Dringlichkeit einer Veränderung wahrgenommen wird. Auch niedrige Zuversicht wird als ambivalenter Zustand gesehen mit der Annahme, dass eine 100%ige Nicht-Zuversicht nicht möglich ist, also die Möglichkeit der Verstärkung der - wenn auch sehr geringen - zuversichtlichen Anteile besteht (vgl. ebd., S. 156).
1.5 Selbstwahrnehmungstheorie
Der Selbstwahrnehmungstheorie nach Daryl Bem zufolge können Einstellungen, Meinungen und Gefühle, die nicht genau definierbar oder vieldeutig sind, durch Beobachtungen des eigenen Verhaltens und der Situation, in der sich das Verhalten abspielt, erschlossen werden. Anknüpfend an die in der Attributionstheorie[4]formulierten Annahme, dass Menschen versuchen das Verhalten anderer Menschen zu verstehen, um zu einem Kausalzusammenhang oder einer sinnvollen Erklärung zu kommen, geht die Theorie der Selbstwahrnehmung davon aus, dass Menschen die selben Attributionsprinzipien, die sie auf andere anwenden, auch auf sich selbst anwenden (vgl. Bem 1974, S. 74 ff.)
Wenn demnach Verhalten und dessen Bedingungen eine Grundlage für Meinungen und Einstellungen sind, dann ist die Veränderung individuellen Verhaltens eine Möglichkeit, eigene Meinungen und Einstellungen zu ändern – kurz gesagt: Einstellungen folgen (unter bestimmten Bedingungen) Verhalten. Das entspricht der Möglichkeit der Reduktion kognitiver Dissonanzen, bei welcher neue konsonante Kognitionen hinzugefügt werden, um z. B. das mit ursprünglichen Einstellungen dissonante Verhalten zu rechtfertigen und somit „richtig“ zu stellen; auch hier folgt dem Verhalten eine (neue) Einstellung (vgl. Bem 1974, S. 73).
In der „Motivierenden Gesprächsführung“ finden sich auf diesen Überlegungen aufbauende Komponenten. In Verbindung mit der Selbstwirksamkeitstheorie gehen Miller und Rollnick davon aus, dass die Aussagen, die eine Person bezüglich ihrer Änderungsbereitschaft und Selbstwirksamkeit macht, diese verstärken im Sinne von: „Wenn ich dem zuhöre, was ich sage, dann erfahre ich, was ich glaube“[5]. Dieses kann sich in Richtung Widerstand entwickeln z. B. bei konfrontierender Ansprache und reaktanter Gegenteilsbekundung; im Sinne „Motivierender Gesprächsführung“ werden änderungsbezogene, zuversichtliche Aussagen gefördert (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 41).
Ebenfalls wird auf den Annahmen der Selbstwahrnehmungstheorie in Verbindung mit der kognitiven Dissonanztheorie aufgebaut bei der Förderung von Problemerkenntnis, z. B. über das Führen eines Konsumtagebuches von Menschen mit problematischem Substanzkonsum, welches tatsächliches Verhalten widerspiegelt und häufig eigene Vorstellungen der Einstellungen zum Konsum revidiert und kognitive Diskrepanzen fördert.
1.6 Selbstregulationstheorie
Das von Frederic Kanfer entwickelte Selbstregulationsmodell geht davon aus, dass bei Menschen bei unerwarteter Unterbrechung eines automatisierten routinemäßigen Verhaltensflusses oder ausbleibender erwarteter Wirkung des Verhaltens ein Prozess der Selbstregulation einsetzt. Solche Unterbrechungen können ungewohnte Situationen, veränderte Umweltbedingungen oder Lernerfordernisse sein. Selbstregulation meint, „... dass eine Person ihr eigenes Verhalten im Hinblick auf selbstgesetzte Ziele steuert; die Regulation erfolgt durch eine Modifikation des Verhaltens selbst oder durch eine Einflußnahme auf die Bedingungen des Verhaltens“ (Kanfer, Reinecker und Schmelzer 2000, S. 33). Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand und die Motivation zur Erreichung des Zieles setzt den Prozess der Selbstregulation in Gang. Selbstregulation verläuft in drei grundlegenden, sich ggf. mehrmals wiederholenden Phasen:
1. Selbstbeobachtung: absichtliches Beobachten des eigenen Verhaltens in Beziehung zum entsprechenden Zielverhalten
2. Selbstbewertung: Vergleich der durch Selbstbeobachtung erhaltenen Informationen mit Standards; bei Nichterreichen des Standards ist Lernprozess möglich, indem Verhalten geändert wird
3. Selbstverstärkung: bei Erreichen eines Verhaltens, welches dem Standard entspricht, folgt positive Selbstverstärkung und Fortführung der unterbrochenen Handlungskette; bei Nichterreichen neuer Verhaltensversuch oder Abbruch des Prozesses und/oder Änderung der Standards, wenn sie sich als ungeeignet für das Erreichen des Handlungszieles erweisen (vgl. Kanfer 1977, S. 373 f.).
Dieses einfache Grundmodell wurde mehrfach weiterentwickelt und berücksichtigt zunehmend mehr Variablen wie z. B. Affekte, soziale Normen, Attributionen und zirkuläre Prozesse innerhalb der Phasen (vgl. Kanfer, Reinecker und Schmelzer 2000, S. 40 f.). Ebenso wie die den Alltag bestimmenden nützlichen automatisierten Handlungsketten (wie z. B. Autofahren, Alltagsgespräche führen etc.) können pathologische Reaktionen Merkmale von Automatisierung aufweisen (z. B. komplexe Verhaltensmuster bei riskantem Alkohol- oder Drogenkonsum). Bei den letztgenannten Verhaltens- und Handlungsweisen kann durch die Stimulation der Selbstregulation eine Veränderung angeregt werden (vgl. ebd., S. 35).
Ein Spezialfall der Selbstregulation stellt die Selbstkontrolle dar. Kennzeichnend für Selbstkontrolle ist das Auftreten von mindestens zwei konflikthaft empfundenen Verhaltensalternativen. Die beiden Grundmuster von Selbstkontrolle finden sich im Widerstehen einer Versuchung und im Ertragen einer sehr unangenehmen Situation, jeweils um letztlich langfristig einen positiven Effekt und damit ein bestimmtes sich gesetztes Ziel zu erzielen, z. B. fördert der Verzicht auf Süßigkeiten das Idealgewicht oder der angstbesetzte Gang zum Zahnarzt kann spätere Schmerzen verhindern. Selbstkontrolle setzt intrinsische Motivation zum Erreichen eines Zieles voraus. Wenn das Verhalten (wie im obigen Beispiel das Naschen) kein Konflikt für die Person darstellt und die langfristigen Nachteile kein Problem und die Vorteile nichts Erstrebenswertes sind, ist das Selbstkontrollkonzept nicht anwendbar (vgl. Kanfer 1977, S. 58 ff.).
Die praktische Umsetzung der Stimulation von Selbstregulation und/oder der Förderung intrinsischer Motivation für Verhaltensänderung im Beratungs- und Therapiebereich ist das verhaltenstherapeutische spezifische Interventionsmodell der „Selbstmanagement-Therapie“. „Die Selbstmanagement-Therapie geht davon aus, daß der Patient im Laufe des therapeutischen Prozesses effektive Fähigkeiten zur Selbstregulation und Selbstkontrolle entwickeln kann; diese Fähigkeiten helfen ihm, seine eigenen, meist erst noch zu klärenden Ziele zu erreichen, wobei diese Ziele im wesentlichen auch für die Gemeinschaft akzeptabel sein sollen“ (ebd., S. 43). Im Idealfall werden im Therapieprozess sieben aufeinander folgende Phasen durchlaufen:
1. Eingangsphase - Schaffung günstiger Ausgangsbedingungen (u. a. Bildung therapeutisches Bündnis; Klärung von Rollen und Erwartungen)
2. Aufbau von Änderungsmotivation und vorläufige Auswahl von Änderungsbereichen (aktive Klärung und Förderung der Änderungsmotivation, vorläufige Auswahl von Änderungsbereichen)
3. Erstellung einer funktionalen Verhaltensanalyse und Ableitung des funktionalen Bedingungsmodells (weitere Präzisierung der Problemdefinitionen)
4. Vereinbarung therapeutischer Ziele
5. Planung, Auswahl und Durchführung therapeutischer Interventionen
6. Evaluation der therapeutischen Fortschritte
7. Erfolgsoptimierung und Therapiebeendigung.
Jeder Phase werden konkrete Handlungsanweisen für die Therapeuten sowie Anforderungen für die Klienten zugeordnet (vgl. Kanfer, Reinecker und Schmelzer 2000, S. 139).
Miller und Rollnick bezeichnen die Theorie der Selbstregulation als ein grundlegendes Erklärungskonzept für ihre Annahmen bezüglich der Veränderung von Problemverhalten, insbesondere der Ambivalenz und darauf aufbauende Strategien „Motivierender Gesprächsführung“ (vgl. Miller und Rollnick 1999, S. 14). Miller schließt u. a. aus der Theorie der Selbstregulation, dass Veränderung wahrscheinlich wird, wenn eine Person 1. ein erstrebenswertes Ziel (der diskrepante Wert zum gegenwärtigen Verhalten) und 2. die reale Möglichkeit zur Erreichung dieses Zieles sieht (vgl. Miller 1998, S. 6). Dem Ansatz der „Motivierenden Gesprächsführung“ liegt entsprechend auch ein ähnliches Menschenbild wie dem von Kanfer zugrunde, demzufolge menschliches Streben im Kern auf Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Selbstregulation und Selbständigkeit abzielt und die Möglichkeiten dazu prinzipiell im Menschen angelegt sind (vgl. Kanfer, Reinecker und Schmelzer 2000, S. 4). Dieses Menschenbild zeigt sich wiederum in der Grundhaltung von „Motivierender Gesprächsführung“ Klienten gegenüber (partnerschaftliche Beziehung, Autonomie des Klienten). Betrachtet man die ersten vier Phasen der Selbstmanagementtherapie findet man fast übereinstimmende Strategien und Annahmen wie in der „Motivierenden Gesprächsführung“. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass störungsspezifische Methoden erst ab Phase fünf zum Einsatz kommen, auf die Miller und Rollnick verzichten. Trotzdem sind die ersten vier Phasen der Selbstmanagementtherapie nicht einfach mit „Motivierender Gesprächsführung“ gleich zu setzen, da es sich einmal um vorbereitende Phasen auf Behandlung handelt und „Motivierende Gesprächsführung“ die weitere Entwicklung in alle Richtungen offen lässt.
1.7 Transtheoretisches Modell der intentionalen Verhaltensänderung
Das Transtheoretische Modell zur intentionalen Verhaltensänderung, kurz: TTM, wurde maßgeblich von Prochaska und DiClemente entwickelt. „Transtheoretisch“ bestimmt sich aus dem Versuch, Konstrukte, die aus verschiedenen Theorien stammen und jeweils Teile von Verhaltensänderungsprozessen beschreiben, in einem Modell zu integrieren (vgl. Keller, Velicer und Prochaska 1999, S. 25). Das TTM erfasst deskriptiv die Motivation zu einer Einstellungs- und Verhaltensänderung im Hinblick auf ein konkret definiertes Problemverhalten. Das darauf abgestimmte Interventionsmodell integriert wirksame Komponenten unterschiedlicher Psychotherapieschulen. Das Modell umfasst vier Dimensionen der Verhaltensänderung: Stadien, Prozesse, Merkmale und Kontext. Unabhängig davon, ob die Verhaltensänderung allein oder mit professioneller Hilfe erreicht wird spielen diese Dimensionen eine wichtige Rolle. Im deutschsprachigen Raum wurde das TTM von Keller, Velicer und Prochaska (vgl. 1999, S. 17 f.) eingeführt.
Im Folgenden werden die vier Dimensionen kurz dargestellt:
➙ Stadien der Veränderung: Im Stadium derAbsichtslosigkeitgibt es noch keine kognitive Auseinandersetzung mit dem Problemverhalten. Im Stadium derAbsichtsbildungfindet eine Auseinandersetzung statt, die jedoch noch nicht zur konkreten Verhaltensänderung führt, da hohe Ambivalenz besteht. Im Stadium derVorbereitungwird eine konkrete Absicht zur Veränderung des inzwischen als problematisch erkannten Verhaltens gebildet; konkrete Handlungsvorsätze und Pläne zur Realisierung des Zieles werden gefasst. ImHandlungsstadium werden die Vorsätze aktiv umgesetzt. Im StadiumAufrechterhaltungsteht die Stabilisierung der Verhaltensänderung und das Vermeiden von Rückfällen im Mittelpunkt. Im Stadium derStabilisierung besteht eine hohe Selbstwirksamkeit das veränderte Verhalten weiterhin aufrechtzuerhalten und eine sehr geringe Versuchung zum alten Verhalten zurückzukehren. Rückfällesind ein ausgesprochen häufiges Phänomen des Veränderungsprozesses. Das lineare Durchlaufen der Stadien von der Absichtslosigkeit bis zur Aufrechterhaltung ist eher die Ausnahme als die Regel, meist werden die Stadien mehrmals durchlaufen. Rückfälle auf ein früheres Niveau sind in jedem Stadium möglich. Diesem entspricht die Annahme eines spiralförmigen Stadienverlaufs (siehe Abb. 2). Ein Rückfall muss nicht bedeuten, wieder bei Null zu beginnen – es ist möglich aus den Fehlern zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen (vgl. Freyer 2006, S. 27 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Spiralförmiger Verlauf des Veränderungsprozesses nach dem TTM (Freyer 2006, S. 29)
➙ Prozesse der Verhaltensänderung: Die Stadien der Verhaltensänderung stellen die zeitliche Dimension des TTM dar. Die Prozesse oder auch Bewältigungsstrategien sind es, die das Voranschreiten von einem zum nächsten Stadium bewirken. Zehn Prozesse wurden aus einer vergleichenden Analyse führender Therapiesysteme abgeleitet. Unterschieden werden fünfkognitiv-affektive(Steigern des Problembewusstsein, emotionales Erleben, Neubewertung der persönlichen Umwelt, Selbstneubewertung, Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen) und fünfverhaltensorientierte Veränderungsprozesse(Selbstverpflichtung, Kontrolle der Umwelt, Gegenkonditionierung, Nutzen hilfreicher Beziehungen, Selbstverstärkung). In den frühen Stadien der Verhaltensänderung (Absichtslosigkeit, Absichtsbildung) stehen die kognitiv-affektiven Prozesse im Vordergrund, in den späteren Stadien (Vorbereitung, Handlung, Aufrechterhaltung) sind die verhaltensorientierten Prozesse bedeutsamer. Der praktische Nutzen aus der Zuordnung einzelner Prozesse zu bestimmten Stadien besteht in der Möglichkeit, verbindliche Aussagen darüber zu treffen, wann Personen (in welchem Stadium), was (Strategien) tun können, um ihr Verhaltensziel zu erreichen bzw. welche Interventionen wann sinnvoll sind (vgl. Keller, Velicer und Prochaska 1999, S. 25ff.).
➙ Merkmale der Verhaltensänderung sind die Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance im Sinne einer vereinfachten Version des Entscheidungsmodells[6]von Janis und Mann. Selbstwirksamkeit umschreibt das Ausmaß an Zuversicht, ein bestimmtes Verhalten ausüben zu können und ist ein wichtiges Kennzeichen für Handlung und andauernden Erfolg. Die Entscheidungsbalance beschreibt das Resultat einer Kosten-Nutzen-Relation der Verhaltensänderung. Sie gilt als wichtiger Faktor für das Voranschreiten von einem frühen Stadium zum nächsten (vgl. Freyer 2006, S. 34).
➙ Der Kontext des gesamten Veränderungsprozesses beinhaltet verschiedene Umstände, die in ihrer Kombination und Interaktion eine Verhaltensänderung erleichtern oder erschweren, z. B. die aktuelle Lebenssituation, Überzeugungen und Einstellungen, interpersonelle Beziehungen, soziale Systeme bzw. Netzwerke und stabile Persönlichkeitseigenschaften (vgl. Freyer 2006, S. 34).
Das TTM wird meist im Zusammenhang mit „Motivierender Gesprächsführung“ genannt als praktische Methode zur Umsetzung des Modells vorwiegend in den ersten drei Stadien. „Motivierende Gesprächsführung“ sieht ebenso wie das TTM die intentionale Verhaltensänderung als einen dynamischen Prozess an. Beide Ansätze fordern keine Änderungsmotivation als Voraussetzung und keine sofortige Änderung, sondern passen sich der individuellen Änderungsbereitschaft des Klienten an. Wesentliche Erkenntnisse über Veränderungsprozesse stimmen überein (z. B. Betonung von Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance, Kontext). Um „Motivierende Gesprächsführung“ zu praktizieren, braucht es nicht dringend die genaue Zuordnung in die Stadien des TTM, da „Motivierende Gesprächsführung“ selbst als Phasenkonzept in bestimmten aufeinander folgenden Schritten konzipiert ist. Das Verdienst des TTM ist hier, dass einem Veränderungsprozessmodell von problematischen Verhalten motivationale Phasen zugeordnet wurden und dargestellt wurde, dass ein Voranschreiten in den Stadien mit gezielten Interventionen möglich ist. Auch ist es praktisches Erklärungsmodell für Klienten hilfreich, um z. B. die Normalität von verschiedenen Stadien der Verhaltensänderung zu vermitteln und (Selbst-)Etikettierungsprozesse zu vermeiden.[7]
1.8 Klientenzentrierte Therapie
Der aus der Humanistischen Psychologie kommende Ansatz wurde von Carl Rogers entwickelt. Das Hauptziel der klientenzentrierten Therapie ist die Förderung des gesunden psychischen Wachstums des Individuums. Klientenzentrierte Therapie lässt sich eher „...charakterisieren als Einstellung, Haltung, eine Seinsweise, nicht als eine Technik ...“ (Rogers 1991, S. 135). Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt zum größten Teil auf dem Prozess der therapeutischen Beziehung und weniger auf den Symptomen oder ihrer Behandlung (vgl. Rogers 1991, S. 17).
➙ Menschenbild/Grundannahmen: Der Ansatz geht von der Annahme aus, „... daß der einzelne die hinlängliche Fähigkeit hat, konstruktiv mit all jenen Aspekten seines Lebens fertig zu werden, die potentiell dem Bewußtsein gegenwärtig werden können“ (Rogers 1992, S. 37). Nach Rogers verfügt der Organismus über die angeborene Neigung, alle seine Fähigkeiten so zu entwickeln, dass sie ihn erhalten oder fördern (Aktualisierungstendenz). Reife, gut angepasste Menschen urteilen auf der Grundlage ihrer eigenen Bewertungen dessen, was intrinsisch befriedigend ist und der Selbstverwirklichung dient. Dieses gesunde Wachstum wird durch fehlerhafte Lernmuster behindert, welche die Person veranlassen, anstelle der Bewertungen, die die eigene Psyche und der eigene Körper liefern, Bewertungen von anderen zu übernehmen. Ein Konflikt zwischen dem eigenen natürlichen positiven Selbstbild (Selbstkonzept) und negativen Kritiken von außen führt zu Angst und Unglücklichsein. Dieser Konflikt oder dieseInkongruenzkann sich außerhalb der bewussten Aufmerksamkeit abspielen, so dass eine Person Gefühle des Unglücklichseins und eines geringen Selbstwertes erlebt, ohne den Grund zu kennen (vgl. Zimbardo 1992, S. 556).
➙ Grundbedingungen für Veränderung: Eine hilfreiche therapeutische Umgebung ermöglicht es dem Klienten, sich selbst neu zu beurteilen und Verhaltensalternativen zu finden, um die eigene Entwicklung zu fördern. Wenn der Berater/Therapeut drei Grundbedingungen in seiner Beziehung zum Klienten herstellen kann, so dass sie phänomenologisch bedeutsam für den Klienten sind, dann kommt es zu einer therapeutischen Veränderung. Diese Bedingungen sindeinfühlsames Verstehen (Empathie), unbedingte positive WertschätzungundEchtheit bzw. Kongruenz. Alle drei Bedingungen können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sie ergeben nur im Zusammenspiel mit o. g. Grundhaltung den Entwicklung fördernden Effekt. In einer Atmosphäre deruneingeschränkten positiven Wertschätzungkönnen die Gefühle des Klienten anerkannt, angenommen und geklärt werden. Der Klient wird angenommen und respektiert, wie er ist und zu keinem Zeitpunkt bewertet. Der emotionale Stil und die Einstellung des Therapeuten ermöglichen dem Klienten, sich neu mit seinen persönlichen Konflikten und Erfahrungen auseinanderzusetzen und die errichtete - nun nicht mehr benötigte - Abwehr abzubauen. In der Beziehung zum Klienten ist der Berater/Therapeut er selbst, das heißt, er ist sich dessen, was er erlebt oder empfindet bewusst und kann es auch angemessen mitteilen. Zusätzlich zu dieserEchtheitversucht der Berater/Therapeut die Erlebnisse und Gefühle des Klienten und deren Bedeutung sensibel zu erfassen. Umfassende vom Klienten erlebteEmpathiedes Beraters/Therapeuten als tiefgreifendes und umfassendes Verstandensein und Akzeptanz ist ein bestärkendes Erlebnis für den Klienten. Das, was der Berater/Therapeut von der Welt des Klienten verstanden hat, spiegelt er ihm. Die klientenzentrierte Therapie bemüht sich um ein nicht-direktives Vorgehen, bei dem der Berater/Therapeut das Streben des Klienten nach Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung lediglich unterstützt, aber nicht lenkt (vgl. Zimbardo 1992, S. 557). Klientenzentriert heißt letztlich, dass das Zentrum des therapeutischen Prozesses im Klienten selbst liegt, welcher Tempo und Richtung bestimmt (vgl. Rogers 1991, S. 59).
In der „Motivierenden Gesprächsführung“ gehen Miller und Rollnick ebenso wie Rogers davon aus, „..., dass eine klientenzentrierte Beziehung, in welcher der Therapeut bestimmte Merkmale aufweist, die beste Voraussetzung für die Entwicklung einer veränderungsförderlichen Atmosphäre darstellt“ (Miller und Rollnick 1999, S. 21). Als das erste der Interventionsprinzipien und als „das Fundament, auf dem die motivierende Gesprächsführung aufbaut“ gilt das Prinzip der Empathie und die ihr zugrunde liegende Einstellung der Akzeptanz als grundlegendes und definierendes Merkmal des Ansatzes (Miller und Rollnick 2004, S. 58). Echtheit/Kongruenz als die dritte - von Rogers als die grundlegendste - der Therapeuteneinstellungen (in nicht zu trennender Verbindung mit Empathie und Akzeptanz) benannte Bedingung wird im Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ nicht vordergründig benannt, wird aber in den ethischen Leitlinien (siehe Punkt 2.2.5 in dieser Arbeit) implizit berücksichtigt.
Den Grundsatz des nicht-direktiven Vorgehens geben Miller und Rollnick weitgehend auf, da es aus ihrer Sicht bei gesundheitsschädigendem Verhalten eine Zielrichtung gibt, in die Veränderung führen sollte - eben die Aufgabe oder Reduktion des schädigenden Verhaltens. Bewusste Verstärkung von Änderungssequenzen („change talk“[8]) und der Einsatz bestimmter Fragen werden direktiv zur Exploration und Auflösung der Ambivalenz in Richtung Veränderung eingesetzt (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 125). Letztlich entscheidet zwar der Klient über Ziel und tatsächliche Verhaltensänderung, durch die Verstärkung dem Ziel entsprechender Aussagen aber wird in diesem Punkt der klientenzentrierte Ansatz nach Rogers verlassen. Miller und Rollnick gehen ebenfalls von einem grundsätzlichen Veränderungspotential eines jeden Menschen aus, sehen die Richtung dieser Veränderung nicht so optimistisch wie Rogers, der von einem grundlegenden Potential einer positiven Veränderung ausgeht. Miller und Rollnick räumen auch die Möglichkeit des nicht-direktiven Vorgehens in der „Motivierenden Gesprächsführung“ ein bei Situationen, in denen es nicht um eine spezielle Verhaltensänderung geht und das Ziel und Entscheidungen auf dem Weg dorthin mit Ambivalenzphänomenen einhergehen (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 131).
Die Zusammenführung von „klientenzentriert“ und „direktiv“ in der Definition der „Motivierenden Gesprächsführung“ (vgl. ebd., S. 47) und das ausdrückliche Beziehen auf die klientenzentrierte Therapie bleibt missverständlich, da aus Rogers Sicht Klientenzentrierung und direktives Führen nicht vereinbar sind und dem Gesamtansatz widersprechen.
Miller und Rollnick betonen, dass sie „klientenzentriert“ vorwiegend in Verbindung sehen mit der von Rogers postulierten Grundhaltung der Empathie und Akzeptanz (vgl. ebd., S. 47).
[...]
[1]Reaktanz ist ursprünglich ein Begriff aus der Physik und bezeichnet einen Blindwiderstand.
[2]Freiheit ist hier gemeint als Wahl zwischen Entscheidungsoptionen (ob, wann und wie gehandelt / sich verhalten wird) und wird auch als Erwartung von Kontrolle angesehen (vgl. Dickenberger 2006, S. 96 ff.).
[3]Schreibt sich eine Person ein negatives Ereignis selbst und zudem stabilen Ursachen zu, verringert dies ihr Selbstwertempfinden und sie erwartet eher auch in Zukunft negative Ereignisse. Kommt dazu, dass die Person glaubt, dass von ihr nicht zu beeinflussende (globale) Faktoren ursächlich für negative Ereignisse verantwortlich sind, generalisieren sich Misserfolgserwartungen und bewirken Hilflosigkeit (vgl. Försterling 1994, S. 237).
[4]Als Attributionstheorien werden theoretische Ansätze bezeichnet, die untersuchen, wie Menschen Ereignisse auf ihre zu Grunde liegenden Ursachen zurückführen, um sie zu verstehen, vorherzusagen und zu kontrollieren (vgl. Försterling 2006, S. 354).
[5]Bem und Kollegen haben in zahlreichen Untersuchungen festgestellt, dass Menschen für diesen „Selbstüberredungs-Effekt“ umso empfänglicher werden, je freier sie sich in der Situation fühlen und wenn sie solche Aussagen unter Bedingungen machen, von denen sie selbst annehmen, dass sie unter diesen Bedingungen die Wahrheit sagen (z. B. in Befragungen bei einem Anwalt) (vgl. Bem 1978, S. 82 f.).
[6]Janis und Mann postulieren vier Kategorien von Vor- bzw. Nachteilen, die von Bedeutung für Entscheidungsprozesse sind (Nutzen/Schaden für die Person selbst oder für andere; Anerkennung/Ablehnung durch die Person selbst oder für andere). Im vorliegenden TTM wird die einfachere Variante der Unterscheidung von wahrgenommenen Vor- und Nachteilen einer Verhaltensänderung gewählt (vgl. Keller, Velicer und Prochaska 1999, S. 29 f.).
[7]Rogers nannte seinen Ansatz zunächst nicht-direktiv, später klientenzentriert, womit die Verlagerung des zentralen Interesses von der Beratertechnik zur Beratereinstellung verdeutlicht werden sollte (vgl. Rogers 1992, S. 30).
[8]In der deutschen Ausgabe von Miller und Rollnick wurde der Begriff als Fachbegriff in englischer Sprache belassen. „Change talk“ sind die änderungsbezogenen Äußerungen von Klienten, die ihre Fähigkeit, ihre Bereitschaft, ihre Gründe, ihre Wünsche und ihre Selbstverpflichtung zum Ausdruck bringen (vgl. Miller und Rollnick 2004, S. 25).
Details
- Titel
- Theorie und Praxis der „Motivierenden Gesprächsführung“ in der Suchthilfe
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 72
- Katalognummer
- V297915
- ISBN (Buch)
- 9783958200357
- ISBN (PDF)
- 9783958205352
- Dateigröße
- 5026 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Grundannahme Grundhaltung Interventionsprinzip Beratungsmethode sozialpsychologische Theorie
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2007, Theorie und Praxis der „Motivierenden Gesprächsführung“ in der Suchthilfe, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297915
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.