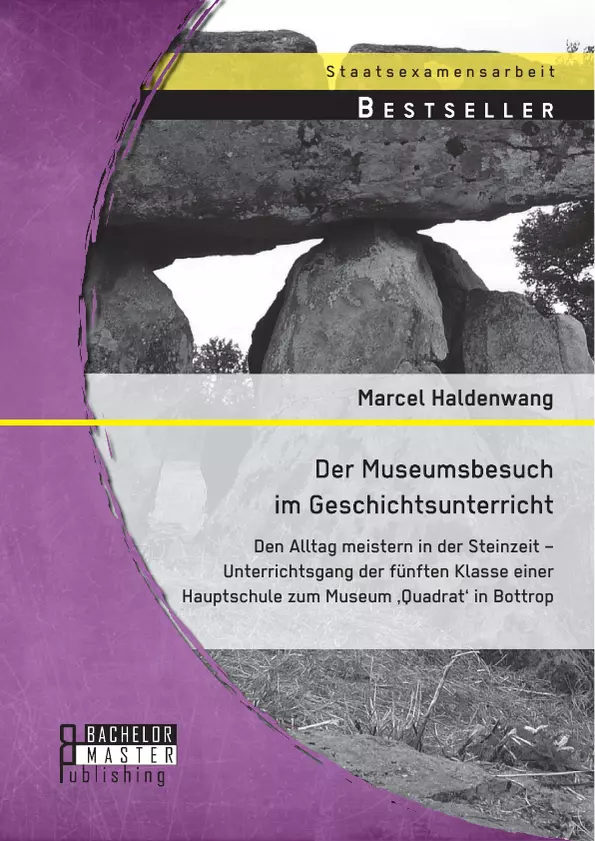Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos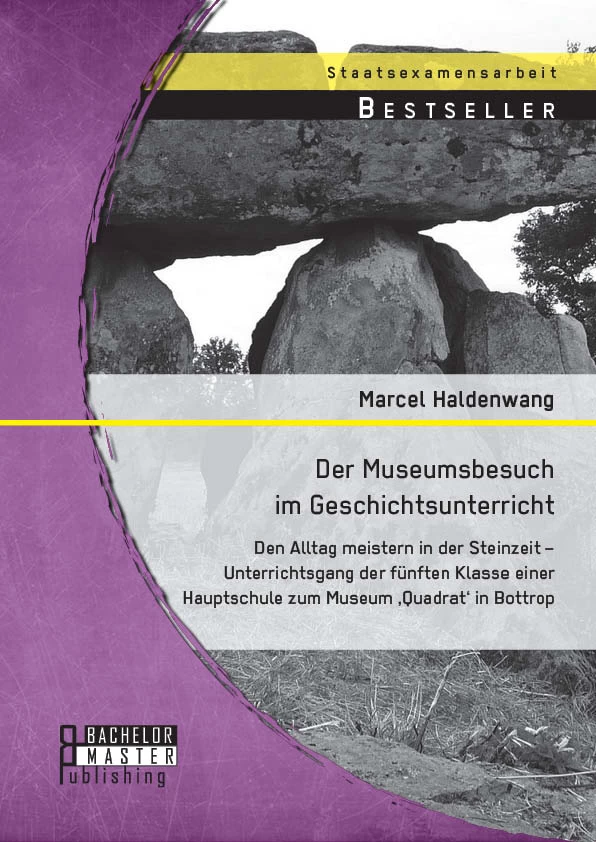
Der Museumsbesuch im Geschichtsunterricht: Den Alltag meistern in der Steinzeit - Unterrichtsgang der fünften Klasse einer Hauptschule zum Museum 'Quadrat' in Bottrop
Examensarbeit, 2005, 45 Seiten
Autor

Kategorie
Examensarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,7
Leseprobe
2. Überlegungen zum außerschulischen Lernort „Museum“
2.1. Perspektiven angesichts des Erziehungsnotstands
Kapitel 2.2. enthält eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Sachquellen“. Das könnte den Eindruck erwecken, dass sie das Charakteristische eines Museumsbesuchs sind. Der Museumsbesuch wäre dann eine Unterrichtsmethode unter anderen. Hey betont aber, dass der Museumsbesuch wie die historische Exkursion im Allgemeinen mehr als eine Unterrichts methode für den Geschichtsunterricht seien, sie seien eine Unterrichts form. Das Kennzeichnende sei, dass man die Schule verlasse. Deswegen fasst er den Museumsbesuch unter seinen relativ weitgefassten Exkursionsbegriff, weil das „Herauslaufen“ (excurrere, excursio) so entscheidend sei, und hält es für zweitrangig, ob die gegenständliche Quelle am originalen Ort, im Museum oder im Archiv aufgesucht wird.[1] Andere Geschichtsdidaktiker wie Ziegler grenzen den Museumsbesuch hingegen von der Exkursion ab.[2] Auch wenn die Diskussion möglicherweise nicht zu entscheiden ist, sie zeigt, wie wichtig beim Museumsbesuch der Gesichtspunkt „ außer schulischer Lernort“ neben dem Gesichtspunkt „Sachquellen“ ist.
Auch außerhalb des Klassenzimmers zu lernen, das war bereits eine wesentliche Forderung der Reformpädagogik. Diese Art des Lernens wurde damals v. a. damit begründet, dass ein solcher Lernort Gelegenheit zur Selbsttätigkeit, zum bewussten Sehen und Hören und zur körperlichen Ertüchtigung biete, zudem den geforderten Erlebnisunterricht ermögliche und auch die in der Heimatkunde sichergestellt geglaubte Lebensnähe gewähre.[3] Heute wird das außerschulische Lernen v. a. damit begründet, dass angesichts dessen, was man unter dem Schlagwort „veränderte Kindheit“ subsummiert – etwa „Naturferne“ durch „Innenraumsozialisation“ oder „Medienkindheit“ –, die Schule kompensatorisch wirken und vermehrt Möglichkeiten zur primären sinnlichen Erfahrungen bieten und Erfahrungsräume zurückgewinnen müsse.[4] Besonders betont wird zudem das erhebliche Motivationspotential, das außerschulische Lernorte für den Unterricht im Allgemeinen wie den Geschichtsunterricht im Besonderen haben; in erster Linie wird die Schüler ein Lernort außerhalb des Klassenzimmers motivieren – die Befragung scheint das für die Klasse 5b zu bestätigen –, aber die Unterbrechung des alltäglichen Unterrichtstrotts und die Herausforderung, den Unterricht in ungewohnter Umgebung zu gestalten, sozusagen auf einer öffentlichen Bühne und nicht bloß hinter verschlossener Klassentür, kann sicher auch für den Lehrer befreiend und motivierend wirken. Bedenkenswert ist aber, dass sich dieser positive Effekt der erhöhten Motivation und Lernbereitschaft nicht per se einstellen muss; durchaus denkbar ist der Fall, wo – evtl. erzwungene und didaktisch nicht durchdachte – Museumsbesuche den Effekt haben, dass das Interesse an Geschichte schwindet. Zur Fähigkeit des Besichtigens und Reisens angeleitet zu werden, ebenso wie Interesse zu wecken, mit offenen Augen v. a. für die geschichtliche Dimension Besichtigungen auch über die Schulzeit hinaus zu unternehmen – diese Aufgaben schreibt überdies Rohlfes den Exkursionen zu.[5]
Wie einleitend bereits erwähnt, soll hier der außerschulische Lernort aber v. a. daraufhin untersucht werden, was er für das Klassenklima und die Disziplin leisten kann angesichts der problematischen Schüler in dieser Klasse und des oft beklagten[6] und gerade bei vielen Schülern dieser Klasse zu beobachtenden Erziehungsnotstandes. Außerschulische Lernorte werden seit jeher im Zusammenhang mit dem Thema „Schulleben“ diskutiert,[7] wobei „Schulleben“ der umfassendere Begriff ist und nicht bloß außerunterrichtliche Elemente, sondern die „erzieherische Grundausrichtung allen schulischen Handelns umfasst“.[8] Und wie im Zusammenhang mit dem Thema „Schulleben“ so stellt sich auch hinsichtlich des Themas „außerschulischer Lernort“ die Frage, ob und inwieweit Schule und Staat überhaupt eine Erziehungsfunktion zukommen.[9] Dem Lehrer, der der Auffassung ist, dass Schule primär den Auftrag hat, Wissen im weitesten Sinn zu vermitteln, und dass Erziehung die ureigenste Aufgabe der Familie ist, könnte der skizzierte Erziehungsnotstand eigentlich egal sein; er könnte argumentieren, dass Schule und Staat nicht in jede Bresche springen sollen, die durch häusliche Versäumnisse entsteht, sie es auch gar nicht können, weil für Erziehung ein Konsens über Werte notwendig ist, den ein weltanschaulich neutraler Staat nur schwerlich finden kann. Und dennoch muss sich der Lehrer, der Klassen wie die beschriebene unterrichten möchte, eingestehen, dass ein gewisses Maß an erzieherischem Engagement notwendig ist, soll Unterricht überhaupt erst stattfinden können. Ein solcher Lehrer liest daher mit Interesse, welch weiterer positiver Effekt dem Verlassen des Klassenraums zugesprochen wird. Es ist das gemeinsame Gruppenerlebnis, es sind die intensiveren Sozialkontakte, die im Schulbetrieb gerade zwischen dem Lehrer und den Schülern leicht vernachlässigt werden. Ruf bringt diesen Gesichtspunkt mit folgenden Worten auf den Punkt: „Wir alle wissen, dass der herkömmliche Unterricht im Klassenraum zur Entfaltung eines ausgewogenen Sozialverhaltens nicht immer den geeigneten Rahmen bietet.“[10] An die Stelle der den Schulunterricht formenden disziplinierenden Elemente treten auf der Exkursion andere Kohäsionskräfte, indem die Schüler in der fremden Umgebung aufeinander angewiesen sind, aufeinander warten und Anschluss an die Gruppe halten müssen oder etwa aufgrund der Verkehrsmittel pünktlich sein müssen. Führt nicht der Lehrer durchs Museum, sondern ein „Experte“ des Museums, rückt der sonst übliche Wissensvorsprung des Lehrers in den Hintergrund. Das eingeschliffene Rollenverhalten kann dadurch möglicherweise aufgelockert werden.[11] Will der Lehrer allerdings nicht alles dem Museumsexperten überlassen – dessen bessere Sach- und Ortskenntnis steht die bessere Kenntnis des Lehrers von seiner Klasse gegenüber –, bietet sich ja auch das „Team-teaching“ an. Der Lehrer könnte auch zusammen mit seinen Schülern eine Museumsrallye durchführen und wäre dann wie seine Schüler in der Rolle des lernenden Laien. Auf diese Weise ergeben sich im Idealfall partnerschaftliche Arbeits- und Gesprächssituationen. Durch all diese Perspektiven eröffnet sich u. U. gerade zu einer schwierigen Lerngruppe ein neuer Zugang. In Kapitel 3.1.2. wird im Einzelnen darzulegen sein, was schon im Vorfeld unternommen wurde, um Konflikte innerhalb der Lerngruppe möglichst auszuschließen und im Museum die angesprochenen Kohäsionskräfte wirksam werden zu lassen.
2.2. Perspektiven für das historische Lernen – die Begegnung mit Sachzeugnissen
Läge dem Lehrer nur seine Funktion als Erzieher im Sinn, könnte er einen beliebigen außerschulischen Lernort aufsuchen, die ihm alle bezüglich den von ihm verfolgten erzieherischen Zielen in ähnlicher Weise entgegenkämen. Der Lehrer, dem darüber hinaus das historische Lernen im Sinn liegt, sieht sich mit einer erheblich engere Auswahl an außerschulischen Lernorten konfrontiert; zu nennen sind hier v. a. die historische Landschaft, der historische Bau, Stadterkundungen, Gedenkstätten, Kriegsgräber, Konfessions-, Sprach oder Kulturgrenzen, Archive, Bibliotheken und – last, not least – das Museum.
Im Museum wird man v. a. Quellen in Form von Sachzeugnissen begegnen, deshalb soll auf dieses Genre genauer eingegangen werden. Auch vor dem Hintergrund, dass die geschichtsdidaktische Literatur beklagt, bei der Geschichtslehrerausbildung komme der Umgang mit Bildquellen und alten Gegenständen gegenüber dem Umgang mit Textquellen zu kurz,[12] erscheint es sinnvoll, sich über die Sachquellen Klarheit zu verschaffen. Die Ausführungen sind über den Museumsbesuch hinaus anwendbar, nämlich immer dann, wenn der Lehrer auch im „normalen“ Unterricht Sachquellen einsetzt, und das „Handbuch Medien im Geschichtsunterricht“ appelliert an den Lehrer, auch im Unterricht vermehrt Sachquellen einzusetzen.[13] Es bemängelt, dass die meisten Autoren, die überhaupt auf die unterrichtliche Verwendung von gegenständlichen Quellen eingingen, vorschlügen, sie in Museen oder auf Exkursionen aufzusuchen, statt zu erwägen, dass historische Gegenstände auch – von Schülern wie Lehrern – mit in den Unterricht gebracht werden könnten.[14] Die Ausführungen gelten ferner nicht nur für den Museumsbesuch, sondern auch den Archivbesuch, geht man wie etwa Hey davon aus, dass man sich bei den dort untergebrachten Akten und Urkunden nicht nur für die Textaussage, sondern auch für ihre Gegenständlichkeit interessiert (z. B. Schrift, Beschreibstoff, Siegel, Stempel, Flecke, Einrisse, Handvermerke, Streichungen, Verbesserungen).[15]
2.2.1. Typen von Sachzeugnissen
Mobile und immobile Sachzeugnisse
Zunächst müssen mobile und immobile Sachzeugnisse unterschieden werden. Für die immobilen gilt, dass sie im Museum oder an ihrem Standort aufgesucht werden müssen. Die mobilen können (theoretisch) mit in die Schule gebracht werden – was überdenkenswert ist angesichts des v. a. zeitlichen Aufwands eines Museumsbesuchs; denn bliebe der Einsatz von Sachquellen auf Museumsbesuche beschränkt, wäre er sicher höchst selten. Allerdings können auch mobile Gegenstände oft nicht in die Schule mitgebracht werden, wenn sie selten und wertvoll sind und nicht so ohne weiteres ohne Vitrine etc. verliehen werden können. Pandel und Schneider weisen darauf hin, dass zahlreiche Museen Schulen sog. Museumskoffer, die Nachbildungen von besonders bedeutsamen Ausstellungsstücken enthalten, verleihen.[16] Der Museumskoffer wie die seltener anzutreffenden Museumsbusse und wie mobile Ausstellungen von Museen gehören zu einer „Museumspädagogik, die das Museum verlässt“ und die deshalb für Schulen interessant sein könnte, weil sie u. U. zur Schule selbst kommt.[17] Mit diesen Vorteilen konkurrieren allerdings die in Kapitel 2.1. erwähnten Vorteile eines außerschulischen Lernortes.
Naturprodukte und Artefakte, Tradition und Überrest
Eine noch in Kapitel 3.1.1. im Zusammenhang mit der Museumstypologie anzusprechende Unterscheidung ist die zwischen Naturprodukten und Artefakten. Erstere sind dem naturkundlichen bzw. naturhistorischen Museumstyp zugeordnet, letztere dem Museumstyp „Kunst- und Kulturmuseum“ bzw. „Kunsthistorisches Museum“ (in der weiten Begriffsdefinition, s. u.). Artefakte werden nochmals unterteilt. Die Unterscheidung ist die, die auch hinsichtlich schriftlicher Quellen getroffen wird, nämlich die in absichtlich bzw. willkürlich überlieferte und unbeabsichtigt bzw. unwillkürlich überlieferte Quellen, in Tradition und Überrest.[18] Hinsichtlich der gegenständlichen Quellen entspricht dieser Unterteilung die Unterscheidung von Gegenständen, die schon immer für die Nachwelt bestimmt waren, und solchen Gegenständen, die für einen gegenwärtigen Zweck angelegt wurden und nicht mit der Absicht, die Nachwelt zu unterrichten. In der Literatur werden nahezu als Synonyme zu „Tradition“ vs. „Überrest“ die Begriffe „Kunstgegenstände“ vs. „Realien“[19] und „Semiophoren“ vs. „Gebrauchsgegenstände“ verwendet.[20] Diese Klassifizierung wird man schwerlich bei Fünftklässlern einer Hauptschule anbringen können, für die Selbstvergewisserung des Lehrers sind diese Bemerkungen hingegen unerlässlich.
2.2.2. Chancen der Arbeit mit historischen Sachzeugnissen
Illustration
Augenscheinlich ist die illustrierende Funktion von Sachquellen, d. h. die Aufgabe, Farbe in die Geschichte zu bringen. Marc Bloch schreibt in seinem Buch „Apologie der Geschichte oder Der Beruf des Historikers“, das in die Quellenanalyse einführt, dass man die Gegenwart aus der Vergangenheit verstehen könne und müsse. Dann sagt er aber auch, dass man die Vergangenheit aus der Gegenwart verstehen müsse:[21]
Es bedarf einer harten Anstrengung der Vorstellungskraft, alten Texten Leben einzuhauchen – hier, im Heute, ist das Pulsieren des menschlichen Lebens direkt greifbar. Oft und oft habe ich Berichte von Kriegen und Schlachten gelesen und erzählt. Wüsste ich wirklich im Vollsinn des Wortes „wissen“, was es für eine Armee bedeutet, eingekreist zu werden, und was es für ein Volk bedeutet, besiegt zu werden, wenn ich nicht zuvor selbst diese grässliche Erfahrung gemacht hätte? Was das schöne Wort „Sieg“ alles enthält, wusste ich das wirklich, bevor ich während des Sommers und Herbstes 1918 erleichtert aufatmete? [...] In Wahrheit sind es ja immer unsere täglichen Erfahrungen, denen wir letzten Endes die Elemente zur Darstellung der Vergangenheit entlehnen und die wir dazu mit den erforderlichen Schattierungen versehen. Selbst die Begriffe, die wir zur Charakterisierung vergangener seelischer Zustände und entschwundener Gesellschaftsformen verwenden, ergäben für uns keinen Sinn, wenn wir nicht zuvor gesehen hätten, wie Menschen leben. Da ist es noch hundertmal besser, wenn man an die Stelle dieses unbewussten Durchdrungenseins die bewusste und kontrollierte Beobachtung setzt. Ein großer Mathematiker wird vermutlich nicht weniger bedeutsam sein, wenn er mit geschlossenen Augen durch die Welt geht, in der er lebt. Aber der Gelehrte, der kein Gefallen daran findet, die Menschen, Dinge und Ereignisse um ihn herum wahrzunehmen, verdient vielleicht [...] ein guter Antiquar geheißen zu werden. Auf die Bezeichnung Historiker sollte er besser verzichten.
Bloch bezeichnet als die Haupteigenschaft des Historikers die Auffassungsgabe dem Leben gegenüber.[22]
Der Gedankengang Blochs an sich ist interessant, hier soll aber nur der Gedanke herausgegriffen werden, dass Bloch sagt, es sei sehr schwierig, alten Texten und dem Vergangenen überhaupt Leben einzuhauchen, ihm die Farbe zurückzugewinnen. Bloch sagt deshalb, man müsse das gegenwärtige Leben genau beobachten, um das vergangene zu verstehen. Jedenfalls hat der Geschichtsunterricht hiernach starken Illustrationsbedarf. Und dabei erweisen sich die Sachquellen als äußerst hilfreich, denn sie erleichtern es, Gewesenes im Bewusstsein zu reproduzieren.[23] Sie sind auch deswegen sehr hilfreich, das Gewesene in den Köpfen der Schüler zu reproduzieren, weil sie – anders als das Papier mit abgedruckten Quellen und Sekundärtexten – dreidimensionale Ausdehnung haben und vermitteln können, dass Geschichte neben der zeitlichen eine räumliche Dimension hat.[24]
Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings die Einschränkung Rohlfes, dass „das gegenwärtige Erscheinungsbild [...], soll es zutreffende historische Vorstellungen erzeugen, gedanklich in die oft sehr andersartige Zuständlichkeit und Umwelt früherer Zeiten transportiert werden [muss]“.[25] Als die größte Barriere bezeichnet Hey „die Stummheit der Objekte“.[26] Sie rührt v. a. daher, dass „die historischen Zusammenhänge“, so formuliert es Hoffmann, „in der Ausstellung zerstört [sind]“.[27] Sturm weist darauf hin, dass gerade für das Museum, das eigentlich das Vergangene bewahren wolle, die Gefahr bestehe, dass es den Bruch mit der Geschichte vorantreibe: „Das Museum selbst zersetzt unter Umständen Traditionen.“[28] Sie spricht sogar von einer „Enthistorisierung“ im Museum.[29] Ebenso problematisch wie die Stummheit der Objekte ist es, wenn die Objekte so reden, dass sie verfälschen. Die Art der Darstellung bringt möglicherweise „die Gefahr einer romantisierenden Verfälschung“ mit sich.[30] Ein Hakenpflug, der, gesäubert und imprägniert, in einer Vitrine ausgestellt wird, macht eine andere Aussage als einer, den der Jungsteinzeit-Bauer durch den Acker führte.
Die im Museum ausgestellten Sachzeugnisse müssen also erst wieder zum Sprechen gebracht werden. Rohlfes macht einen interessanten Vorschlag, um diesen Prozess bei den Schülern in Gang zu setzen: „Informationen und Anschauung mögen sich zu einem Gesamteindruck verbinden, in dem das eine das andere trägt: Die Anschauung ruft die Vorstellung herbei, die Vorstellungen erfüllen die Anschauung mit historischem Leben.“[31] Damit ist bereits ein ganz wichtiges Kriterium benannt für die Beurteilung des Arrangements und der Beschriftung der Gegenstände in einem Museum, für die Auswahl der Aktionsform im Museum und – sollte man sich wie im Fall des Museums Bottrop für Forscherbögen entscheiden – für die Gestaltung solcher Bögen. Letztere beispielsweise müssen so konzipiert sein, dass sie die Schüler anregen, sich die Fertigung und auch die Funktionsweise des Gegenstandes vorzustellen, und sich nicht – etwa durch eine zu hohe Textlastigkeit – zwischen den Schüler und Gegenstand stellen und diesen vom Gegenstand ablenken.[32]
Emanzipation
Die erwähnte Funktion von Sachquellen und damit die Funktion eines Museumsbesuchs scheint auf der Hand zu liegen, nämlich illustrieren zu helfen. Ein anderer Aspekt ist weniger offenkundig, er findet sich aber z. B. in einem allgemeindidaktischen Buch unter dem Kapitel „Visualisierung“.[33] Hiernach fungieren Sachquellen im Museum nicht bloß als Illustration des Unterrichts, sondern sie emanzipieren den Schüler gegenüber dem Lehrer. Lenz-Johanns warnt: „Das Museum darf nicht mit einer Lehrmittelsammlung verwechselt werden.“[34] Wenig später gibt er zu bedenken: „Selbsttätigkeit und Emanzipation sind ernst zu nehmende Lernziele.“[35] Diesen Gesichtspunkt herauszustellen dürfte einem Lehrer helfen, den Museumsbesuch zu rechtfertigen, der sich mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, der Besuch eines außerschulischen Lernortes mit seiner intendierten primären sinnlichen Erfahrung und Erlebnishaftigkeit (s. Kap. 2.1.) sei eine Absage an die Rationalität.[36] Im Folgenden soll beleuchtet werden, wie das Museum mit seinen Sachquellen sich geradezu dadurch auszeichnet, dass es die Kinder zur Rationalität und kritischen Prüfung anregt.
Der Schüler lernt an Sachquellen Geschichte nicht mehr nur auf die bloße Autorität des Lehrers hin, er eignet sich nicht länger nur die autoritativen Einsichten des Lehrers an, sondern kann anhand der Anschauung selbst Erkenntnisse gewinnen, er kann selbsttätig Wissen erwerben. Interessant ist, dass gerade die Historiker der Aufklärung, die den verstärkten Quelleneinsatz forderten, das mit diesem Argument begründeten. Die Forderung der Aufklärung war es ja, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen und nicht etwas zu glauben, bloß weil es eine Autorität sagt. Diese Forderung übertrug man auf die Haltung gegenüber historischen Darstellungen. So schrieb der Historiker Danz 1798: „Und es kann anfangs schon genug sein, wenn man seinen Schülern nur einen Wink gibt, dass historische Berichte untersucht und geprüft werden müssen, [sic!] und dass man nicht gleich jede Erörterung glauben dürfe.“[37] Im Zuge der Restauration nach dem Wiener Kongress 1815 wurde dann die sog. „Selbsttätigkeit“, die v. a. eine verstärkte Quellennutzung im Unterricht implizierte, regelmäßig verboten, was eindrücklich die Brisanz des Quelleneinsatzes zeigt.[38]
Die Emanzipationsfunktion von Geschichte scheint heute im Grundsatz unbestritten zu sein. Bergmanns Ausführungen über die Möglichkeiten, durch Geschichtsunterricht Emanzipation zu fördern, lassen im Wesentlichen zwei Aspekte erkennen: Einerseits führt der Geschichtsunterricht Emanzipationsversuche der Vergangenheit vor, die – auch abhängig von den historischen Bedingungen – gelangen oder fehlschlugen.[39] Zum anderen nennt er aber als Möglichkeit der Emanzipation im Geschichtsunterricht „neue Präsentationsformen von Geschichte, die nach Maßgabe des Möglichen vermeiden, den Lernenden Geschichte als fertiges Produkt vorzuführen, vielmehr so angelegt sind, dass die Lernenden zu eigenständigen und durchaus kontroversen Rekonstruktionen der sie betreffenden Vergangenheit kommen können.“[40] Aus diesen Bemerkungen lässt sich ein weiteres Kriterium gewinnen, das es bei der Auswahl des Museums zu beachten gilt: Sind die Gegenstände und Beschriftungen so arrangiert, dass sie der Deutung des Schülers Raum lassen? Wie ist der Duktus des Museumsführers oder des Forscherbogens, apodiktisch oder so, dass der Schüler angeregt wird, seine eigene Rekonstruktion vorzunehmen? Gerade Museen zur Paläontologie müssten sich daraufhin überprüfen lassen, ob die häufig anzutreffende Unsicherheit bei der Datierung zugegeben wird.
Ein Museumsbesuch, der mehr als die Illustration des im Unterricht vermittelten Wissens sein möchte, müsste Schüler überdies dafür sensibilisieren, dass im Museum nur eine Auswahl von Sachzeugnissen zu sehen ist und welche Kriterien bei dieser Auswahl maßgeblich waren. Ein solches Kriterium, das auch einer fünften Klasse schon zu vermitteln ist – der Forscherbogen der Gruppe 3 versucht dies –, ist die unterschiedliche Materialbeschaffenheit der Objekte. Holz z. B. verfault in einer feuchten Umgebung, Obst ebenso usw. Scheinbar banal, aber nicht unbedeutend ist ferner der Gesichtspunkt, dass sich die größeren Gegenstände anders als die kleineren oft noch an ihrer ursprünglichen Stelle befinden, zumal wenn sie widerstandsfähig sind und ein aufwendiger Transport und eine teure Unterbringung im Museum nicht erforderlich oder unmöglich ist, etwa im Falle ganzer Schlösser, Kirchen oder Rathäuser.[41] Für die beschriebene Klasse und Altersstufe sicher (noch) nicht geeignet ist folgender Vorschlag aus der Literatur. Er erscheint nichtsdestotrotz erwähnenswert, weil die Ausführungen den Lehrer auch einer fünften Hauptschulklasse, der auf der Suche nach einem geeigneten Museum ist, sensibilisieren können für die in dem Museum getroffene Auswahl von Sachzeugnissen und die der Auswahl zugrundegelegten Auswahlkriterien. So schlägt Hoffmann vor, der Lehrer solle mit seinen Schülern eine Besichtigung des Magazins machen, um damit den Schülern „die Relativität der allgemein zugänglichen Schausammlung [zu] vermitteln“.[42] Dieser Besichtigung folgen könnte dann die Frage nach den Absichten und Interessen des Museums, die die Auswahl und auch Darstellungsweise beeinflusst haben. Pellens geht so weit, hinsichtlich bestimmter Gegenstände von einem „Politikum“ zu sprechen.[43] Er schlägt bezüglich städtischer Museen z. B. vor, sie darauf hin zu prüfen, wo sie Konzeptionen bestimmter Mehrheitsverhältnisse im Rathaus wiederspiegelten. So lege eine „bürgerliche“ Fraktion u. U. mehr Wert auf die Darstellung der glanzvollen reichsstädtischen Geschichte, während eine den heutigen Unterschichten verpflichtete Fraktion möglicherweise das Gewicht der Darstellung mehr auf den Kampf und das Elend der Unterschichten in vergangener Zeit lege.[44] Ferner zu bedenken ist, dass die Ursprünge des Museums im Selbstdarstellungsbedürfnis der Fürsten liegen. Dementsprechend stellen Museen traditionell v. a. das Schöne, Ruhmbringende und Positive dar, wie Pellens bemerkt.[45] Sollten heutige Museen auch noch in dieser Tradition verhaftet sein, würde das dem Interesse des Historikers und des Geschichtsunterrichts auch an dem Durchschnittlichen und Repräsentativen, eben der Alltagsgeschichte, entgegenstehen. So könnte es sein, dass von 10 verwendeten Exemplaren eines Gegenstandes nur das wertvollste erhalten und ausgestellt ist, das fehlerhafte und Gebrauchsspuren aufweisende aber ausgeschieden ist.[46] Die Interessen von Fürsten dürften bei heutigen Museumserrichtungen keine Rolle mehr spielen. Zu fragen ist aber möglicherweise verstärkt nach den kommerziellen Interessen der Träger. Gerade bei Museen, die v. a. als Touristenattraktion konzipiert sind, müsste man thematisieren, inwiefern hier die Besucherorientierung möglicherweise dem sachlichen Anspruch Abbruch tut. Hat ein Museum eine Museumsgeschichte, werden sich Interessen und Konzeptionen verschiedener Zeiten überlagern. In der Oberstufe wäre es sicher ein interessantes Projekt, der Geschichte eines Museums, seiner Interessensgeschichte und der Geschichte seiner Ausstellungskonzeption, nachzuspüren. Hierbei würden dann nicht allein die Exponate von Quellenwert sein, sondern die Museumskonzeptionen als solche hätten historischen Quellenwert für ihre Entstehungszeit.[47]
Methodenlernen
Eng zusammen mit den vorherigen Bemerkungen zur emanzipierenden Funktion des Quelleneinsatzes hängt der Aspekt des Methodenlernens. Wie wichtig Methodenlernen für den Geschichtsunterricht ist, zeigen die „sieben Todsünden“ der Quelleninterpretation von Pandel. Ironisierend bemerkt er: „Vermeiden Sie Methodenlernen. Machen Sie die Schüler und Schülerinnen nicht mit den methodischen Schritten einer Quelleninterpretation und dem theoretischen Rüstzeug (hermeneutischer Zirkel, Wirkungszusammenhang, Perspektivität, inhaltsanalytische Verfahren) vertraut. Sie geben sonst eines Ihrer wichtigsten Steuerungsmittel aus der Hand, und die Schüler und Schülerinnen könnten sonst ohne ihre Hilfe die Quellen entschlüsseln.“[48] Wie anhand von schriftlichen Quellen können die Schüler auch anhand von gegenständlichen Quellen unterscheiden lernen zwischen absichtlich und unabsichtlich überlieferten Quellen. Sie können den unterschiedlichen Quellenwert beider Quellengattungen kennen lernen. Gerade an Gegenständen zeigt sich, weil sie für sich genommen kaum eine Auskunft, geschweige denn Kausalitäten kundtun, wie wichtig Vorkenntnisse, Vergleiche und von vornherein Fragen an die Quelle sind. Dass die Interpretation gegenständlicher Quellen schwieriger ist als die rein schriftlicher, darin sind sich die Geschichtsdidaktiker weitgehend einig.[49] Interessant ist aber, dass mit dem höheren Schwierigkeitsgrad nicht die Motivation und das Interesse der Schüler abnimmt, wie man es möglicherweise erwartet hätte. Die größere Motivationskraft der gegenständlichen Quelle wiegt die erhöhte Erschließungsschwierigkeit auf bzw. überwiegt diese sogar.[50]
Ohne Zweifel ist es wichtig, dies bei der Planung des Museumsbesuchs zu beachten; auf die Problematik der Stummheit der Objekte wurde bereits eingegangen. Was das Methodenlernen angeht, sollte der Lehrer an die fünfte Klasse dieser Schulform allerdings nicht allzu hohe Erwartungen stellen und sich zufrieden geben, wenn die Schüler – u. U. mehr unbewusst als bewusst – den Vergleich als Methode kennen und ihr Vorwissen bei der Identifizierung steinzeitlicher Funde schätzen lernen. Selbst wenn der Schüler das in der Schule vermittelte oder das sich privat angeeignete Wissen nur mit einer farbigeren Vorstellung verknüpfen würde, wäre damit ein nicht zu unterschätzendes Lernziel, das der Illustration, wie gezeigt wurde, erklommen.
Emotionen
Auch angesichts der Tatsache, dass der Geschichtsunterricht Emotionen möglicherweise zu wenig anspricht, erweisen sich gegenständliche Quellen als vorteilhaft. Hinsichtlich der Emotionen ist es sicher auch sinnvoll, wenn der Lehrer die Schüler auffordert, eigene (gegenständliche) Quellen mit in den Unterricht zu nehmen. Hinsichtlich der Steinzeit dürfte sich das schwierig gestalten, anders als etwa hinsichtlich der Zeit, die die Großeltern der Schüler noch miterlebt haben. Was für viele Gegenstände aus dieser Zeit typisch ist, etwa Kriegsorden oder Feldpost, dass sie nämlich mit Tod, Lebensgefahr und Extremsituationen in Verbindung stehen, muss auch für die Exponate eines Museums gelten: Sie müssen bei den Schülern Emotionen provozieren. Im Museum wird die Emotionalität zwar nie ganz so ausgeprägt sein wie bei Objekten aus der familiären Überlieferung, aber etwa ein Richtschwert zu sehen, mit dem der Scharfrichter einst die verurteilten Delinquenten vom Leben zum Tod beförderte, wird die meisten Schüler durchaus berühren.[51] Gerade ein Museum, das sich als tauglich für eine fünfte Klasse erweisen soll, müsste mit solchen Sachzeugnissen aufwarten können, die die Schüler emotional tangieren.[52]
3. Der Museumsbesuch in Bottrop
3.1. Die Planungs- und Vorbereitungsphase
3.1.1. Die Auswahl des Museums
Der Lehrer muss zunächst ein geeignetes Museum ausfindig machen. Zur Hilfe kommen kann ihm dabei möglicherweise das Internet mit speziellen Museumssuchmaschinen.[53] In dem in dieser Arbeit beschriebenen Museumsbesuch verdankt der Lehramtsanwärter einem Kollegen den Hinweis auf das Museum „Quadrat“ in Bottrop. Dem Hinweis folgte eine erste Vorexkursion, um zu prüfen, ob und inwiefern das Museum das innerschulische Lernen unterstützen kann.
Bei einer solchen Vorexkursion kann sich der Lehrer nicht auf seine Intuition verlassen. Er benötigt ein handfestes Instrumentarium, mit dem er die in Frage kommenden Museen einer kritischen Prüfung unterziehen kann. Da kommt ihm zunächst einmal die in der Literatur zu findende Museumstypologie zur Hilfe. Ebenso kontrovers wie das Verhältnis von Schule und Museum im Allgemein wurde nämlich in der Vergangenheit das Verhältnis von Geschichtsunterricht und verschiedenen Museumstypen diskutiert. Unterschieden werden i. d. R. das Historische Museum, das Kunst- und Kulturmuseum bzw. das Kunst- und Kulturhistorisches Museum, das Naturkundliche bzw. das Naturhistorische Museum, das Technikmuseum, das Orts- und Heimatmuseum wie das Regional- und Landesmuseum, das Völkerkundemuseum und das Freilichtmuseum.[54] Das Historische Museum ist in Deutschland, wie Rohlfes betont, selten, aber es ist auch schwer zu bestimmen, was darunter zu verstehen ist.[55] Die Bezeichnung „Kunst- und Kulturmuseum“ bzw. „Kunst- und Kulturhistorisches Museum“ scheint von den Geschichtsdidaktikern in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet zu werden. Hoffmann versteht unter dem Kulturhistorischen Museum den Museumstyp, der nicht zwischen Realien und Kunstgegenständen unterscheidet und beides ausstellt;[56] hier wird der Begriff in Abgrenzung vom Naturgeschichtlichen Museum verwendet. Rohlfes’ Ausführungen lassen erkennen, dass er unter dem Ausdruck v. a. Museen versteht, die Kunstwerke ausstellen.[57] Denn besuche der Geschichtslehrer ein solches Museum, werde das Verhältnis von Geschichtsunterricht und Kunst-, Kultur- und Geistesgeschichte berührt. Laut Rohlfes ist deren Stellenwert zu einem Randthema im Geschichtsunterricht herabgesunken, Kunstwerke hätten nur noch illustrative Funktion und keine heuristische mehr, lediglich die Bedingungen ihrer Produktion und Rezeption interessierten. Der Museumstyp des Naturkundlichen bzw. Naturhistorischen Museums stellt das Pendant zu dem Museumstyp „Kunst- und Kulturmuseum“ bzw. „Kunst- und Kulturhistorisches Museum“ dar. Der Unterscheidung entspricht die Unterscheidung von gegenständlichen Quellen in Naturprodukte und Artefakte (s. o., Kap. 2.2.1.). Die fürstlichen Sammlungen, die sog. „Kunst- und Wunderkammern“, enthielten noch beides. Seit dem 18. Jahrhundert trennte man dann zunehmend die beiden Gattungen in unterschiedlichen Museumstypen.[58]
Das Museum „Quadrat“ in Bottrop vereint drei völlig unterschiedliche Museumstypen unter einem Dach. Zum einen beherbergt es eine Dauerausstellung mit Werken von Josef Albers. Des weiteren sind hier Wechselausstellungen, vornehmlich mit Werken konstruktivistischer Künstler, untergebracht. Das dritte Museum trägt die Bezeichnung „Museum für Ur- und Ortsgeschichte“. Das Museum besteht aus einem 1976 errichteten, sich aus drei Quadraten zusammensetzenden Gebäude, einem weiteren, 1983 errichteten Gebäude und schließlich einem Altbau, der ehemaligen Oberbürgermeistervilla.[59] Die Albers-Ausstellung ist in dem neuesten der Gebäude untergebracht, die Wechselausstellung in einem der drei Quadrate. Das „Museum für Ur- und Ortsgeschichte“ ist in einem der Quadrate untergebracht sowie auf einer Etage der alten Villa. Die beiden externen Gebäude, also der Bau von 1983 und die alte Villa, sind über Glasbrücken mit dem Hauptgebäude verbunden. Die Bezeichnung „Museum für Ur- und Ortsgeschichte“ verschweigt, dass es sich auch hierbei um die Zusammenführung denkbar unterschiedlicher Sujets handelt. Im Altbau ist zum einen die Stadtgeschichte Bottrops dokumentiert. Dann gibt es, ebenfalls im Altbau, eine naturkundliche Ausstellung, in der die Flora und Fauna der Region auf recht anschauliche Weise dargestellt wird und mit einem technischen Aufwand, den das geschichtliche Museum vermissen lässt; so kann man sich etwa zu den verschiedensten präparierten Vögeln Vogelstimmen anhören. In dem gläsernen Verbindungsgang zwischen den beiden Gebäuden gibt es außerdem eine umfangreiche Mineraliensammlung. Die Erdgeschichte, v. a. die Kreide- und Karbonzeit, wird ebenfalls in der ehemaligen Villa dokumentiert. Die eigentliche Steinzeit-Ausstellung ist auf beide Gebäude aufgeteilt. Der Neubau, eines der drei Quadrate, ist als „Eiszeithalle“ gestaltet. Hier dreht sich alles um die Eiszeit. Am auffälligsten sind die großen Skelette von Mammut, Wollnashorn, Höhlenbär, Elch und Waldwisent. Ins Auge fällt ferner die große, per Knopfdruck verstellbare Schautafel zur Gletschergrenze und deren Verschiebung sowie die riesige Nachbildung eines Fährtenhorizonts. In der Mitte der Eiszeithalle befindet sich eine Art Empore. Dort sind die Artefakte aus dieser Zeit ausgestellt. Im Altbau geht es weiter mit steinzeitlichen Artefakten. Am auffallendsten ist hier das große Modell einer jungsteinzeitlichen Siedlung. An den Steinzeitraum im Altbau schließen sich zwei weitere Räume an. Begeht man den einen, ist man mitten in der Stadtgeschichte Bottrops, begeht man den anderen, ist man in der Bronzezeit.
Versucht man den für die Exkursion relevanten Museumsteil anhand der oben skizzierten Typologie zu klassifizieren, ist er zugleich natur- und kulturhistorisches Museum (letzteres in der weiten Definition, s. o.), das Naturprodukte wie Artefakte beherbergt. Den großen Vorzug dieser Mischform kann man sich leicht vor Augen führen, besichtigt man die Mineraliensammlung oder die erdgeschichtliche Ausstellung. Beides hat nicht annährend die Faszinationskraft wie die Exponate, die dem Schüler sozusagen Witterung geben, dass hier Menschen zugegen waren. Und Artefakte ermöglichen es auch erst, der Forderung gerecht zu werden, wie sie schon im Titel der Arbeit anklingt, nämlich Alltagsgeschichte zu betreiben. Auch wenn die Reaktionen der Schüler für den Berufsanfänger nur schwer im Voraus abzuschätzen sind, das als Gütekriterien für Museen erarbeitete Merkmal, nämlich Gegenstände auszustellen, die Emotionen wecken, schien das Museum „Quadrat“ allein schon mit dem imposanten riesigen Mammutskelett aufzuweisen.
Dass unter den Artefakten auch Kunstgegenstände sind, könnten einige Didaktiker als Problem betrachten, denn dieser Umstand wirft die Frage auf, ob man nun bei einem vom Geschichtsunterricht ausgehenden Museumsbesuch den Gegenstand auch in seiner ästhetischen Dimensionen zu erfassen hat. Hoffmann formuliert noch 1992: „Die ästhetische Codierung der Objekte stellt eine besondere Schwierigkeit dar.“[60] Andere Autoren scheinen keine eindeutige Zuordnung von Gegenstandstypen und Lernbereichen anzustreben. Gerade bei einem fächerübergreifend angelegten Museumsbesuch sollen dann historisches Lernen, ästhetisches Lernen, technisch naturwissenschaftliches Lernen, soziales und politisches Lernen und – etwa im Völkerkundemuseum – interkulturelles Lernen ineinander greifen.[61] Die Kunstgegenstände, auch wenn ihre ästhetische Dimension bei diesem Besuch nicht eigens zum Thema gemacht wird, führen den Schülern zumindest vor Augen, dass die Realität nicht wirklich so segmentiert ist, wie es die Fächertrennung der Schule bisweilen suggeriert.
Die Museumsbezeichnung deutet schon den lokalgeschichtlichen Bezug an, und er zieht sich durch alle Bereiche des Museums. Beispielsweise zu realisieren, dass das meterhohe Mammut in den hiesigen Breiten zu Hause war, dürfte die Schüler beeindrucken, wie auch die Städte des Gletscherrandes (Kleve, Xanten, Wesel, Düsseldorf usw.) für die Schüler eine Bedeutung haben dürften.
Den Ausschlag für dieses Museum gab ferner die Tatsache, dass es von Kamp-Lintfort aus über die Autobahn sehr schnell zu erreichen ist. Die Buskosten würden sich daher auf 7 Euro pro Kind belaufen.[62] Eine Fahrt etwa ins Neandertal-Museum nach Mettmann würde erheblich mehr kosten, die Frage 4 des zweiten Teils der Umfrage hatte überdies ergeben, dass etliche Kinder dieses Museum schon kennen. Wer das Klientel der Hauptschule ein wenig kennen gelernt hat, der ist sich bewusst, dass viele Kinder nicht im Überfluss leben. Aus diesem Grund sehr zu begrüßen ist auch, dass es sich bei dem Museum „Quadrat“ um ein nichtkommerzielles Angebot handelt. Die Kosten würden aus diesem Grund aus den reinen Buskosten bestehen.[63] Überdies würde man, was die Auswahlkriterien der Museumsleitung betrifft, nicht argwöhnisch zu sein brauchen (s. o., Kap. 2.2.2.)
3.1.2. (Schul)organisatorische Voraussetzungen
Schulorganisatorisch müssen bestimmte Voraussetzungen für einen Museumsbesuch geschaffen werden. Dazu gehört, sich angesichts des aus dem Kaiserreich stammenden Stunden- bzw. Dreiviertelstundenrhythmus’ des Unterrichts genügend Zeit von den Kollegen der anderen Fächer zu erbeten – ein Museumstyp, der einen fächerübergreifenden Museumsbesuch zulässt, wird dem Geschichtslehrer dabei helfen, und Stahmer z. B. ist der Auffassung, dass alle Museen vielen Fächern etwas zu bieten haben, fächerübergreifende Ansätze drängten sich geradezu auf.[64] In dem hier beschriebenen Fall würden die ersten beiden Stunden ganz regulär stattfinden, weil das Museum erst um 10.00 Uhr öffnet. Fächerübergreifend wurde insofern gearbeitet, als der Klassenlehrer mit den Schülern eine Bildergeschichte erarbeitet hatte, die im Geschichtsunterricht zum Anlass genommen wurde, Verhaltensregeln für einen solchen Besuch zu erarbeiten.
Wenn ein Museumsbesuch die normale Unterrichtszeit überschreitet, wirft dies das Problem auf, dass die Schüler, die mit dem Schulbus zur Schule gekommen sind, aufgrund der Zeitbegrenzung des Schulbusbetriebs nicht mehr nach Hause gelangen. Der Museumsbesuch war zwar so geplant, dass die Klasse pünktlich zum regulären Schulschluss wieder an der Schule sein sollte, aufgrund der Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs wurden die Eltern aber schriftlich darauf aufmerksam gemacht, dass es zu einer Verspätung kommen kann.[65]
Ein Elternbrief erschien außerdem ratsam, um die Eltern frühzeitig über die Kosten der Exkursion zu informieren. Der entsprechende Erlass der obersten Schulaufsicht, die „Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten“, schreiben dies zwar nur für mehrtätige und solche Veranstaltungen vor, die mit „erhöhten finanziellen Belastungen“ verbunden sind. Auch sind die Schüler während der ganzen Exkursion unter der Aufsicht sowohl des Geschichts- wie des Klassenlehrers; erforderlich wäre für diese Art der Exkursion sicher nur eine Begleitperson.[66] Eine rechtsverbindliche Zustimmung ist daher eigentlich nicht erforderlich,[67] dennoch wurde ein Elternbrief verfasst, nicht zuletzt um die Eltern über die Zielsetzung des Museumsbesuchs in Kenntnis zu setzen.
Für die Genehmigung von Schulfahrten durch den Schulleiter gibt es an der Niersenberg Hauptschule ein unkompliziertes Verfahren. Am schwarzen Brett des Lehrerzimmer hängt das entsprechende Formular, das der Lehrer auszufüllen hat. Die Schulleiterin signiert das Formular dann von sich aus.
Angesichts der beschriebenen, was die Disziplin betrifft, recht lebhaften Klasse zu den ganz wichtigen organisatorischen Vorbereitungen gehörte auch das Erarbeiten von Regeln, wie man sich in einem Museum zu verhalten hat. Die Klasse selbst hatte in Frage 9 des zweiten Teils der Umfrage mehrheitlich Bedenken geäußert, dass sich die Klasse auf einem Ausflug angemessen benehmen kann. Um Regeln zu erarbeiten, wurde die vom Klassenlehrer in Deutsch behandelte Bildergeschichte aufgegriffen, die von einer Familie erzählt, die ein Mammutskelett besichtigt.[68] Der unbeaufsichtigte Hund macht sich an dem Skelett zu schaffen, das schließlich unter großem Getöse zusammenbricht. In der Geschichtsstunde am Tag vor dem Museumsbesuch wiederholten die Schüler diese Geschichte mit Hilfe einer OHP-Folie. Sie waren anschließend aufgefordert, auf ausgeteilte Zettel jeweils eine Regel zu schreiben, die helfen würde, ähnliche Unglücke im Museum „Quadrat“ zu vermeiden. Die Zettel hefteten sie danach an die Tafel und versuchten gleichzeitig die Regeln zu Gruppen zu sortieren. Es folgte ein Unterrichtsgespräch, in dem die Essenz der zahlreichen Regeln noch einmal herausgestellt wurde; für die eigentlich geplante Verschriftlichung auf einem Plakat reichte die Zeit nicht mehr. Im Wesentlichen wurden folgende Regeln erarbeitet – das Problematische des der Aufgabe immanenten Vergleichs der Schüler mit einem Hund schien glücklicherweise niemand bemerkt zu haben: „Leise sein“, „nicht rennen“, „hinter der Absperrung bleiben“, „nicht drängeln“, „nichts anfassen, was man nicht darf“.
Weil der Unterrichtsgang mindestens ebenso sehr wie fachliche Ziele das Ziel verfolgen sollte, das Sozialklima zu verbessern und Kohäsionskräfte freizusetzen, musste ein erhebliches Konfliktpotential unbedingt schon im Vorfeld vermieden werden, nämlich die Konflikte, die die Aufteilung der Klasse in Gruppen mit sich bringen würde. Die Gruppenaufteilung sollte daher schon im Unterricht erfolgen. Um die als schwierig beschriebenen Schüler auf die Gruppen aufzuteilen und in jeder Gruppe einen leistungsstarken Schüler unterzubringen, wurden weder Neigungs- noch Zufallsgruppen gebildet, sondern bestimmte der Lehrer, wer mit wem zusammenarbeiten würde. Auch die Zuordnung der unterschiedlichen Arbeitsaufträge zu den fünf Gruppen würde im Museum der Lehrer vornehmen. Das ermöglichte es, eine Gruppe mit leistungsschwachen Schülern zusammenzustellen, die dann den erheblich leichteren Forscherbogen „Unterwegs in der Eiszeit“ würde bearbeiten können. Zweifellos wichtig ist es, die Schüler mit zunehmendem Alter in die Vorbereitung und Organisation einer Exkursion einzubinden. Die Didaktiker geben aber einmütig zu bedenken, dass sich der Grad der Einbindung nach dem Alter und den Erfahrungen der Schüler richten muss.[69] In das Ermessen der Schüler der Klasse 5b wurde daher gestellt, wer von den vier oder fünf Gruppenmitgliedern sich für die zu vergebenden besonderen Funktionen am besten eignen würde. Zu vergeben waren die Aufgaben des Fotografen, des Zeichners, des Zeitwächters und des Aufpassers; in Gruppen mit fünf Schülern gab es zwei Zeichner.[70] Der Fotograf würde die Verantwortung für den Einwegfotoapparat sowie die Ablichtung all der Gegenstände tragen, die für die Gruppe und ihren speziellen Arbeitsauftrag relevant waren. Während jeder Schüler den Forscherbogen ausfüllen sollte, wenn es um schriftliche Aufgaben ging, wurden die Zeichner beauftragt, die zeichnerischen Aufgaben für die gesamte Gruppe zu erledigen. Der Zeitwächter sollte darauf achten, dass Zeitvorgabe und Arbeitspensum stimmig waren,[71] während der Aufpasser beobachten sollte, ob sich alle an der Arbeit gleichermaßen beteiligten.
3.1.3. Die inhaltliche Vorbereitung
Die Positionen zu der Frage, in welchem Verhältnis Schule und Museum zueinander stehen bzw. zu stehen haben, klafften in der Vergangenheit weit auseinander. Noch 1988 schrieb Rietschel, es könne im Museum nie darum gehen, umfangreiche Lerninhalte zu vermitteln. Die Schule sei eine „Lern-Schule“, das Museum eine „Schule des Sehens“, die die „Lern-Schule“ nur um die visuellen Angebote ergänze. Das Museum sei an sich keine pädagogische Einrichtung. Schulklassen stellten eben nur eine von vielen Besuchergruppen dar, und so sei es falsch, Museumsarbeit einseitig auf die Bedürfnisse von Schulklassen abzustellen.[72] Eine versöhnlichere Position hingegen nimmt etwa Lenz-Johannes ein, der zwar eine Arbeitsteilung der beiden Institutionen Schule und Museum fordert, aber doch von einer „bewusst getrennten und differenzierten Zusammenarbeit zwischen den Institutionen“ spricht.[73]
In der Tat wird man vom Museum nicht verlangen können, dass es sich ganz und gar am Curriculum des Fachs Geschichte auszurichten hat. Einen „deutlichen Bezug zum Unterricht“ fordern aber die Wanderrichtlinien für Schulwanderungen und -fahrten.[74] Die Pflicht des Lehrers ist es also, genau zu untersuchen, wie sich das Museum zu den im Lehrplan vorgeschriebenen Inhalten verhält und wie die Schüler auf den Besuch inhaltlich vorbereitet sind oder noch vorzubereiten sind. In dem hier beschriebenen Fall bildet der Museumsbesuch und seine Nachbereitung den Abschluss der Lerneinheit, aber auch wenn er als Einstieg fungiert oder während einer Unterrichtseinheit geplant ist, ist eine gründliche Vor- und Nachbereitung vonnöten, wenn auch die Intensität der Vor- und Nachbereitung davon abhängt, wo der Museumsbesuch platziert ist.
Das Thema der Unterrichtsreihe war insofern von den „Richtlinien und Lehrplänen“ vorgegeben, als diese als Grundprinzip der Gliederung der Inhalte im Fach Geschichte glücklicherweise an dem chronologischen Prinzip festhalten.[75] Nach dieser prinzipiellen Festlegung werden dann einzelne Gegenstandsbereiche aufgeführt, und der erste dieser Gegenstandsbereiche ist betitelt mit „Spezialgebiet Faustkeile“.[76] Die Konkretisierung der Inhalte dieses Gegenstandsbereichs bleibt recht allgemein, sodass dem Unterrichtenden ein relativ großer Entscheidungsspielraum bleibt, was die Schwerpunktsetzung betrifft. Die schuleigenen Lehrpläne der Hauptschule nehmen daher folgende Konkretisierung vor, indem sie einzelne (Stunden)themen benennen: „die ersten Menschen“, „Jäger und Sammler“, „Lebensformen (Horde)“, „Waffen und Werkzeuge“, „Kunst und Religion“, „die Menschen werden sesshaft“, „die Jungsteinzeit“, „die Bronzezeit“, „neue Berufe“, „die Eisenzeit“, „Üben und Wiederholen“.[77] Im Wesentlichen wurden diese Vorgaben befolgt, außer dass das Thema „Kunst und Religion“ nicht behandelt wurde, stattdessen recht ausführlich die steinzeitliche Tierwelt. Fernerhin nicht behandelt wurde die Eisenzeit, dafür recht ausführlich die Bronzezeit und die mit ihr einhergehende Arbeitsteilung. Die Übungs- und Wiederholungsstunden wurden zwischen den Abschluss des Themas „Jungsteinzeit“ und den Beginn des Themas „Bronzezeit“ platziert. Diese Unterrichtsreihe folgte aufgrund der Quellenlage beinahe per se der geschichtsdidaktischen und sich auch in den Lehrplänen wiederfindenden Forderung nach Berücksichtigung der Alltagsgeschichte.[78]
Der erste der fünf Forscherbögen handelt von den klimatischen Verhältnissen der Eiszeit und knüpft thematisch direkt an zwei Unterrichtsstunden an, die unter der Überschrift „Leben wie im Kühlschrank“ standen. Neu für die Schüler sind die Ausdrücke „Findling“ bzw. „Geschiebe“ und „Tundra“. Die hiernach in dem Forscherbogen zu benennenden Tiere sind den Schülern allesamt aus der handlungsorientierten Sequenz zur steinzeitlichen Tierwelt bekannt, als sie aus Schuhkartons und Pappe mit Steinzeittieren darauf sog. „Steinzeitzoos“ gestalten sollten. Gruppe 2 befasst sich mit den Werkzeugen und der Werkzeugherstellung in der Steinzeit. Dies knüpft an an die Unterrichtsstunde, in der sich die Schüler mit der Herstellung des Faustkeils und den unterschiedlichen Funktionen von Faustkeil, Schaber, Steinmesser und Bohrer befasst haben.[79] Die Abschlagtechnik für die Klingenherstellung ist allerdings neu für die Schüler. Die übrigen Aufgaben erfordern keine besonderen Vorkenntnisse und sind lösbar, wenn die Schüler intensiv suchen. Schwierig gestaltet sich der Eintrag in die Zeittabelle. Zeitleisten sind den Schülern allerdings daher bekannt, dass sie ganz zu Anfang des Schuljahres eine Zeitleiste zu ihrer persönlichen Geschichte angefertigt haben. Ihre Gegenstände in die gleiche Zeitleiste einzutragen war auch Aufgabe von Gruppe 3. Thematisch knüpfte dieser Forscherbogen an die Unterrichtsstunden zur Bronzezeit an. Die Schüler haben das gegenüber der Steinzeit neue Material bereits mit der Beschaffenheit von Stein verglichen und Vorteile benannt,[80] insofern ist der Vergleich des Bronzespeers mit dem Steinspeer für sie – in der Terminologie der Lernzielstufen ausgedrückt – eher eine Reproduktionsleistung, nicht jedoch der Vergleich mit dem Holzspeer. Der Forscherbogen der vierten Gruppe trägt den Titel „Jagen und Jagdbeute in der Steinzeit“. Zwar beschäftigte sich eine Stunde unter dem Thema „Überleben in den Eiszeiten“ mit den unterschiedlichen Tätigkeiten und „Berufen“ in der Steinzeit, wobei das entsprechende, mit den Schülern erarbeitete Tafelbild neben Tätigkeiten wie „Fischen“, „Holz und Beeren sammeln“ auch das „Jagen und Zerlegen von Wild“ enthielt.[81] Insofern gibt es Anknüpfungspunkte. Die Nutzung der einzelnen Bestandteile eines Tieres wurde aber nicht behandelt, sie ist daher neu für die Schüler dieser Gruppe. Gruppe 5 dürfte es, was das nötige Vorwissen angeht, leicht haben. Zum einen liegt das Thema „neolithische Revolution“ noch nicht so lange zurück, zum anderen wurden alle in diesem Forscherbogen genannten Aspekte ausführlich im Unterricht erarbeitet[82] und in einer Übungssequenz per Stationenlernen vertieft. Gespannt sein darf man allerdings, ob die Schüler die Frage zum Unterschied des Verhältnisses des Menschen zu Wolf und Pferd beantworten können, denn diese Thematik (Nahrungsspender vs. Nahrungskonkurrent) war in der Sequenz zur steinzeitlichen Tierwelt besprochen worden und lag schon längere Zeit zurück.
3.2. Die Arbeits- und Durchführungsphase im Museum
3.2.1. Die Schülerarbeitsform
In dieser Phase ist der Lehrer bzw. der Museumsexperte vor die Aufgabe gestellt, die „starre Front zwischen Objekt und Betrachter“ zu überwinden.[83] Das kann, wie im Folgenden gezeigt werden soll, auf verschiedene Weise erfolgen. Urban nennt folgende Vermittlungs- und Aneignungsformen: die Führung, das Museumsgespräch, Audioguides, elektronische Informationssysteme, das Museumstheater sowie Zeitzeugengespräche als Formen der „Kommunikation über Geschichtszeugnisse“, die Besucherinformationen, Arbeitsblätter bzw. Erkundungsbögen als „Textinformationen und Anleitungen zur selbsttätigen Erkundung von Geschichtsobjekten“.[84] Von diesen die visuelle Auseinandersetzung anregenden Vermittlungsformen grenzt er die praktisch-handelnden Aneignungsformen ab. Hierzu zählt er u. a. das Betasten von Gegenständen, das Experimentieren mit historischen Werkzeugen und Nachmachen vergangener Tätigkeiten, das Verkleiden, das Spielen historischer Spiele, den Bau von Modellen, das Zeichnen, die Rekonstruktion von historischen Gegenständen, das Bauen von Standbildern und die szenische Umsetzung historischer Situationen, hier aber – anders als im „Museumstheater“ – durch die Schüler selbst.[85]
Zunächst soll die Diskussion um das Für und Wider von Führung und selbständiger Erkundung aufgegriffen werden, dann die Frage nach dem handlungsorientierten Zugang. Im Grunde ist die Diskussion, ob die Führung oder die selbständige Erkundung vorzuziehen sei, dieselbe wie die um den lehrerzentrierten, instruktionsorientierten Unterricht und den schülerzentrierten, subjektorientierten Unterricht. Weil diese Diskussion hier nicht ausführlich entfaltet werden kann, fällt die eigene Standortbestimmung möglicherweise ein wenig kredohaft aus. Verfechter des eher subjektorientierten Unterrichts fordern – und sie berufen sich dabei häufig auf die psychologische Didaktik,[86] wiewohl die Diskussion älter ist und sich schon in der Diskussion um das Verhältnis von res et verba wiederfindet – eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Der Lehrer gestaltet demnach nur noch eine anregende Lernumgebung und fungiert in der Hauptsache als Coache, der allenfalls Hinweise, Rückmeldungen und Empfehlungen gibt. Dass jeder Schüler nach seinem eigenen Lerntempo und seinem individuellen Lernweg lernen kann, ist wichtig. Vertreter des lehrerzentrierten Unterrichts hingegen betonen das Erfordernis des Lehrens, und das nicht zuletzt aufgrund der Einsicht, dass die Lebenszeit des Menschen begrenzt ist und er gar nicht alles selbst entdecken kann. Mit Wagner aus Goethes Faust argumentieren sie gewissermaßen: „Die Kunst ist lang, / Und kurz ist unser Leben.“
Für das Museum „Quadrat“ stellte sich die Frage, welche Vermittlungsform vorzuziehen sei, erst gar nicht, weil Führungen nicht angeboten werden und Forscherbögen käuflich sind, die auf Schüler zugeschnitten sind. Zwei Aspekte des – bisweilen mit Sicherheit überschätzten – selbsttätigen Lernens fallen bei der selbständigen Erkundung eines Museums allerdings positiv ins Gewicht: Bei der selbständigen Erkundung kann buchstäblich ein individuelles Tempo und ein individueller Weg gewählt werden. Man könnte befürchten, die Fülle an Exponaten überfordere die Kinder leicht. Lässt man die Kinder allerdings selbständig durch das Museum gehen, erweist sie sich möglicherweise gerade als Vorteil. Die Schüler können dort im Museum anfangen, wo sie einen Zugriff finden, weil sie bestimmte Interessen haben oder Vorwissen mitbringen. Die Vielzahl an Exponaten bietet also eine Chance, dass sich eine Schnittmenge zwischen Museum und dem Schüler findet. Von dort aus kann der Schüler dann auch an für ihn abwegigere Themen und Exponate herangeführt werden.
3.2.2. Die Schülerarbeitsmaterialien
Das Museum „Quadrat“ bietet verschiedene Forscherbögen an. Für Kindergarten- und Grundschulkinder gibt es einen Malbogen zur Höhlenmalerei. Dann gibt es einen Arbeitsbogen, der mehr der Orientierung im Museum dient und Suchaufträge zu den verschiedenen Museumstypen enthält. Des weiteren gibt es Erkundungsbögen, auf denen die in der „Eiszeithalle“ ausgestellten Skelette abgebildet sind. Die Schüler sind hierbei aufgefordert, die Skelette genau zu untersuchen und auf dem Bogen einzuzeichnen, welche Skelettteile vermutlich nachgebaut wurden. Anschließend sollen sie um die Skelette einen Umriss zeichnen. Überdies gibt es einen Bogen zur „Eiszeithalle“, insbesondere den Eiszeiten und der eiszeitlichen Tierwelt. Fünftens schließlich bietet das Museum eine Zusammenstellung von sechs Forscherbögen an, die so konzipiert sind, dass eine Lerngruppe sich in sechs Gruppen aufteilen und jede Gruppe jeweils einen der in „schwer“, „mittel“ und „leicht“ klassifizierten Bögen bearbeiten kann. Zu den sechs Bögen gehören jeweils sechs originale steinzeitliche Funde.
Die Bögen wurden zunächst sorgfältig gesichtet. Vor allem wurde geprüft, inwiefern sie die Schülern anregen, sich den ursprünglichen Verwendungszweck der Exponate zu vergegenwärtigen und Geschichte selber zu rekonstruieren, und ob die Diktion nicht zu belehrend ist. Von den sechs zusammengehörigen Bögen wurden nach sorgfältiger Sichtung vier ausgewählt. Zwei schieden aus, weil sie für die Zielgruppe zu schwer erschienen; erstaunlicherweise war einer der ausgesonderten Bögen vom Museum als „mittelschwer“ klassifiziert worden. Weil die Klassenstärke fünf Gruppen erfordert, musste für einen der aussortierten Bögen Ersatz geschaffen werden. Sich problemlos integrieren zu lassen und von daher gut geeignet schien der Eiszeitbogen. Allen fünf Bögen und den eigentlichen Arbeitsaufträgen wurde jetzt noch jeweils ein Bogen des Skelett-Untersuchungs-Spiels vorangestellt, weil dies als ausschließliche Aufgabe für eine Gruppe zu einfach gewesen wäre und auf diese Weise ein leichter und vermutlich motivierender Einstieg konzipiert werden konnte. Der vorangestellte Bogen wurde als „Einstellungstest“ für Steinzeitforscher deklariert. Die Bögen selbst mussten nun noch sorgfältig überarbeitet werden, weil einige Formulieren zu fachsprachlich klangen (z. B. der Titel „Neolithische Revolution“) oder die Aufgabenstellung zu unkonkret für die Lerngruppe war (z. B. „Überlegt einmal, welches Verhältnis damals zwischen den Menschen und diesen Tieren bestand“ geändert in „Waren die beiden Tiere Freund oder Feind des Menschen?“). Auf einer zweiten Vorexkursion ins Museum, bei dem alle fünf Forscherbögen durchgearbeitet wurden, um eventuelle Schwierigkeiten im Voraus aufzudecken, zeigte sich, dass es teilweise sehr schwierig war, die erforderlichen Gegenstände zu finden. Wo es erforderlich schien, wurden die Bögen daher um Hinweise auf den ungefähren Ausstellungsort erweitert.
Alle Gruppen hatten also zunächst einmal denselben Arbeitsauftrag an unterschiedlichen Tieren zu erledigen – so kam es zu keinem Gedränge vor einem Tier – und kamen dann zum Lehrer zurück, um sich die für die Bearbeitung ihres eigentlichen Bogens notwendigen Steinzeitfunde abzuholen. Die Gruppe „Werkzeuge und Werkzeugherstellung“ erhielt zwei Faustkeile und zwei Klingen, die Gruppe „Jagdwaffen und Jagd in der Steinzeit“ zwei Speerspitzen aus Bronze, die Gruppe „Jagen und Jagdbeute in der Steinzeit“ zwei Rentiergeweihstücke sowie zwei Mammutzähne, die Gruppe „Erfindungen in der Jungsteinzeit“ zwei Wolfsschädel und zwei Pferdeknochen; die Eiszeit-Gruppe bekam keine gesonderten Steinzeitfunde und befasste sich mit den ausgestellten Funden.
Vor dem Hintergrund des Spektrums an analytischen und handlungsorientierten Aktionsformen, die Urban für Museen vorstellt, stellt sich nun unwillkürlich die Frage, ob und inwieweit die hier gewählte Aktionsform handlungsorientiert ist. Mit Ausnahme der Eiszeit-Gruppe bekamen alle Gruppen Gegenstände, die sie anfassen durften. Sie waren auch aufgefordert, die Objekte auf verschiedene Weise zu fixieren, also zu skizzieren, zu umschreiben oder zu fotografieren.[87] In dem Bogen „Jagen und Jagdbeute“ wurde eine Aktionsform ergänzt, die Urban unter den handlungsorientierten Formen nennt, nämlich das Nachstellen einer Jagdszene, und zwar in der Hoffnung, dadurch „statische Exponate“, wie es Burk und Claussen formulieren, zu „dynamisieren“.[88]
3.3. Die Auswertungsphase
3.3.1. Die Reflexion der Teamarbeit
Der Auswertungsphase kommt laut Burk und Claussen v. a. die Aufgabe zu, „das Geschehene zu ,fassen‘, in Beziehung und Zusammenhang zu bringen, Eindrücke zu ,verdichten‘ und zu strukturieren“.[89] Unverkennbar ist, dass sie dabei nur fachliche Ziele vor Augen haben. In der unmittelbar auf den Museumsbesuch folgenden Stunde sollten die Schüler aber zunächst einmal ihren Gruppenarbeitsprozess bewerten. Diese Reflexion wurde der Reflexion des inhaltlichen Ertrags vorgezogen, weil der Eindruck sich vermutlich schneller verflüchtigen würde. Die Bewertung der Teamarbeit verfolgte dabei eine zweifache Zielsetzung: Zum einen sollten die Schüler dafür sensibilisiert werden, wie wichtig Teamarbeit ist, nämlich so wichtig, dass sie auch zum Thema im Unterricht gemacht wird. Zum anderen sollte die Bewertung dem Lehrer einen Einblick in die Prozesse innerhalb der einzelnen Gruppen liefern, sodass dieser abschätzen konnte, ob die Zielsetzung, die er mit dem Aufsuchen eines außerschulischen Lernortes verfolgt hatte, erreicht worden war. Erstmals in dieser Klasse zum Einsatz kam die „Zielscheiben-Methode“, die den Schülern zunächst am OHP erläutert wurde, bevor dann jeder Schüler einzeln den Bogen auszufüllen hatte. Hiernach setzten sich die Schüler in ihrer Gruppe zusammen, um ihre Bewertung der einzelnen Aspekte zu vergleichen. Zwei Gruppen verstanden diese Anweisung wohl falsch und begannen ihre Ergebnisse innerhalb der Gruppe anzugleichen; zum Teil machten sie das noch wieder rückgängig, doch die Ergebnisse der Bewertung von Gruppe 2 und 4 haben nur einen eingeschränkten Aussagewert. Den Kategorien „voll zutreffend“, „größtenteils zutreffend“, „eher nicht zutreffend“ und „gar nicht zutreffend“ wurden für die Auswertung Werte von 1 bis 4 zugeordnet, um die Ergebnisse vergleichen zu können; die Werte dürfen dabei nicht als Notenwerte missinterpretiert werden. Zu der positivsten Einschätzung kamen die Schüler bei der Frage, ob sich alle für die gemeinsamen Aufgaben verantwortlich gefühlt hätten (1,4 im Durchschnitt). Gefolgt wird diese Einschätzung von der Bewertung der Frage, ob sich alle Schüler an die vereinbarten Regeln gehalten hätten (1,8). Hiernach folgt die Einschätzung der Fragen, ob zügig gearbeitet worden sei (1,9) und ob die Aufgabenverteilung gut funktioniert habe (2,0).
Aufschlussreicher ist es, sich die Bewertung der einzelnen Gruppen anzuschauen. Gruppe 1, 2 und 4 kommen alle im Mittel zu einer Bewertung von 1,7, Gruppe 3 zu einer Bewertung von 1,9 und Gruppe 5 zu einer Bewertung von 2,1. Dies deckt sich erstaunlich genau mit der Beobachtung, die man während des Museumsbesuchs machen konnte und die auch eine Durchsicht der Forscherbögen der einzelnen Gruppen ergibt. Die gute Zusammenarbeit in den Gruppen 2 und 4 lässt sich in den Forscherbögen daran ablesen, dass alle Gruppenmitglieder dieselben Antworten eintrugen und sogar denselben Wortlaut verwendeten. Gruppe 3 hatte sich während der selbständigen Erkundung in zwei Fraktionen aufgelöst (S. und V. vs. M. und G.); S. und V. hatten sich von den beiden anderen Gruppenmitgliedern Angst einjagen lassen, die gesagt hatten, dass es in der Villa spuke, und waren davongelaufen, zurück in die Eiszeithalle. Bei der Frage, was ihnen überhaupt nicht gefallen habe, schrieben alle Mitglieder der Gruppe 3, ihnen habe nicht gefallen, dass sich die Gruppe getrennt bzw. aufgelöst habe. In Gruppe 5 war gelegentlich Unmut aufgekommen, weil S. mit dem Fotografieren gelegentlich überfordert zu sein schien oder ein Selbstportrait dem Abfotografieren von Steinzeitgegenständen vorzog. Nach Protest aus der Gruppe hatte sie zu weinen begonnen. Alle befragten Schüler dieser Gruppe bezogen sich in der Antwort auf die Frage, was ihnen überhaupt nicht gefallen habe, auf den Vorfall; ein Schüler schrieb z. B.: „Nichts, außer dass meine Gruppe nicht so gut zusammengehalten hat. Dass S. nicht zu [sic!] viel heulen tut.“ Die Auswertung jedenfalls zeigt, dass die Gruppen die Qualität ihrer Teamarbeit schon recht realistisch einzuschätzen wussten.
3.3.2. Die Auswertung des inhaltlichen Ertrags
In der Literatur werden die verschiedensten Aktionsformen beschrieben, um den inhaltlichen Ertrag des Museumsbesuchs auszuwerten und zu sichern. Originell und im Sinne einer Geschichtsdidaktik, die Ernstfallsituationen fordert, wäre es, wenn Schüler einen eigenen Museumsführer oder eine eigene Museumszeitung erstellen würden. Hierbei motivierend und am Ende auch zufriedenstellend ist das Gefühl, etwas zu leisten bzw. geleistet zu haben, was über den Ertrag eines „normalen“ Geschichtsunterrichts hinausgeht und auch von allgemeinem Interesse ist.[90] Den Museumsführer könnte man auch ins Internet stellen, er hätte damit zumindest potentiell ein weltweites Publikum. Weil der Museumsbesuch von Sachquellen bestimmt ist, ist auf die Möglichkeiten hinzuweisen, die das Basteln von Modellen bietet. Das „Handbuch Medien im Geschichtsunterricht“ widmet dem Erstellen von Modellen ein eigenes Kapitel von 10 Seiten,[91] d. h., das Thema wird ernsthaft diskutiert. Rohlfes stellt als Vorteil von Modellen heraus, dass sie die „Erscheinungsfülle des Originals auf seine Grundverhältnisse reduzieren und eine wichtige Ergänzung und Stütze der unmittelbaren Anschauung“ sind.[92] Schüler könnten auch Repliken, wie sie das Museum verwendet, selbst herstellen, etwa einen steinzeitlichen Bohrer oder Hakenpflug. In Sammelmappen können Texte, Bilder, Zeichnungen usw. dauerhaft aufbewahrt werden und von Zeit zu Zeit durchgesehen werden, um die Erinnerung wieder wachzurufen. Nicht zu vergessen ist schließlich das Unterrichtsgespräch, in dem Erlebnisse und Eindrücke ausgetauscht und in dem der eigene Lernfortschritt reflektiert werden kann.
Die Überlegungen zu der für diese Lerngruppe sinnvollsten Form für die inhaltliche Auswertung des Besuchs wurden flankiert von der Erfahrung, was man diesen Schülern und dieser Altersgruppe zumuten kann, ohne sie zu überfordern. Die Entscheidung fiel daher für das Erstellen von Collagen, auf denen die Fotos, Zeichnungen und Notizen, die im Museum angefertigt worden waren, in Beziehung gesetzt werden sollten, und zwar so, dass auch Unbeteiligte Einblick in den Sachverhalt bekommen können.
Zunächst waren die einzelnen Gruppen aufgefordert, ihre Forscherbögen miteinander zu vergleichen und anhand der Anstreichungen des Lehrers zu überarbeiten. Gruppe 1 hatte zwar nahezu alle Aufgaben fehlerfrei bearbeitet. Originell sind in dieser Gruppe v. a. die Begründungen für die Tiere, die ihnen am besten gefallen haben. Y. etwa hat sich für den Löwen entschieden, „weil der so stark ist und sehr schlau und er sich gut verteidigen kann“. S. hat sich für das Mammut und den Lemming entschieden, denn „der Lemming ist so klein, und das Mammut ist so groß“. Alle haben aber den Umriss um die Skelette in Aufgabe 1 vergessen zu zeichnen. Gruppe 2 hat das Tier, dessen Skelett sie zu untersuchen hatten, nicht benannt und auch den Umriss vergessen zu zeichnen, ein starkes Indiz dafür, dass die Arbeitsanweisung nicht gründlich gelesen oder nicht verstanden wurde. Nicht bearbeitet wurde die Frage zum Unterschied von Abschlag- und Kerntechnik, und die Datierung der Gegenstände in der Tabelle fehlt. Die Arbeitsbögen von Gruppe 3 weisen die größten Lücken auf; die mutmaßlichen Ursachen sind schon genannt worden, zudem weist der Fragebogen einige Schwächen auf, v. a. diejenige, dass die Fragen aufeinander aufbauen und die nachfolgende nicht gelöst werden kann, wenn die vorhergehende unbeantwortet bleiben musste. In dieser Phase der Überarbeitung brauchte diese Gruppe daher die besondere Anleitung des Lehrers. Ausgezeichnet bearbeitet wurden die Arbeitsaufträge der Gruppe 4. Die Gruppe hat beide Gegenstände exakt identifiziert und macht auch plausible Vorschläge für die Nutzung der Komponenten eines Tieres. In dieser Gruppe zeichneten alle Schüler die Gegenstände und nicht bloß M., der Zeichner. Auch Gruppe 5 identifizierte, wie die Bögen erkennen lassen, beide Gegenstände korrekt. Wie man während des Museumsbesuchs beobachten konnte, gingen sie dabei geradezu methodisch vor. T. entdeckte im naturkundlichen Museum, dessen Besichtigung gar nicht vorgesehen war, einen Hundeschädel und stellte die Ähnlichkeit mit den Wolfsschädeln fest. Die Probleme innerhalb der Gruppe spiegeln sich hier – anders als in Gruppe 3 – nicht in den Arbeitsergebnissen wieder.
Nach der Überarbeitung der Bögen lautete für alle Gruppen der Arbeitsauftrag, die Fotos, Zeichnungen und Informationen auf eine Wandzeitung zu bringen, von denen die Gruppe glaube, dass es die anderen Schüler interessieren werde. Der Klasse wurde eine Collage gezeigt, die Schüler einer anderen Klasse zu einem gänzlich anderen Thema erstellt hatten, denn diese Präsentationstechnik war neu für die meisten Schüler der Klasse. Schwierigkeiten bereitete der Arbeitsauftrag insbesondere Gruppe 2, denn hier hatte der Fotograf so gut wie keine brauchbaren Fotos angefertigt. Der Gruppe wurden schließlich Fotos des Lehrers zur Verfügung gestellt. Bei der Präsentation hingegen brillierte Gruppe 2, als v. a. Benedikt äußerst eloquent die Arbeitsergebnisse vorstellte. Die anderen Schüler erkannten auch – durch eine Karikatur und den Beobachtungsbogen dafür sensibilisiert, dass ein Vortrag interessant sein muss und wie man ihn ansprechend gestalten kann – recht treffsicher, dass die Präsentation der Gruppe 2 die beste war. Große Schwierigkeiten, über ihr Thema zu berichten, hatte hingegen Gruppe 1, zumal der Schüler, der die Präsentation am ehesten in die Hand hätte nehmen können, in dieser Stunde fehlte. Die „Zuschauer“ votierten daher bei den meisten Fragen mehrheitlich mit „nein“.
[...]
[1] Vgl. Bernd Hey, Die historische Exkursion. Zur Didaktik und Methodik des Besuchs historischer Stätten, Museen und Archive (Stuttgart: 1978) (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, Bd. 19), S. 12.
[2] Vgl. Bernd Hey, Exkursionen, Lehrpfade, alternative Stadterkundungen, S. 728, in: Klaus Bergmann u. a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik (Seelze-Verlber: 51997), S. 727-731. Eine Hey entgegengesetzte Position bezieht auch Waltraud Schreiber, „Die historische Exkursion. Versuch einer Typologie“, S. 30, Geschichte, Politik und ihre Didaktik, Heft 1/2 (1999), S. 30-36.
[3] Vgl. Karlheinz Burk, Claus Claussen, Zur Methodik des Lernens außerhalb des Klassenzimmers, S. 18, in: Karlheinz Burk, Claus Claussen (Hrsg.), Lernorte außerhalb des Klassenzimmers II. Methoden, Praxisberichte, Hintergründe (Frankfurt a. M.: 1981) (Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd. 49), S. 18-41; ausführlicher vgl. Karlheinz Burk, Claus Claussen, Lernorte außerhalb des Klassenzimmers. Didaktische Perspektiven, S. 16-19, in: Karlheinz Burk, Claus Claussen (Hrsg.), Lernorte außerhalb des Klassenzimmers I. Didaktische Grundlegung und Beispiele (Frankfurt a. M.: 1980) (Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd. 45), S. 5-25.
[4] Vgl. z. B. Melanie Ohde, Karl A. Wiederhold, Mit Grundschulkindern das Kunstmuseum entdecken (Donauwörth: 1994), S. 9. Die gebotene Kürze der Arbeit lässt es nicht zu, aber diese Schlagworte müssten eigentlich auf ihre problematischen kulturkritischen Implikationen hin untersucht werden und auf die darin enthaltende naive Modernitätskritik. Dringend geboten wäre auch eine Kritik der gerade in der Lehrerausbildung um sich greifenden „Lerntypentheorie“, für die jede empirischen Nachweise fehlen und die auf bloßer Spekulation beruht. Dankenswerterweise erstmals Kritik an ihr wird geübt in Hans-Jürgen Pandel u. a. (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht (Schwalbach/Ts.: 2004), S. 51 f.
[5] Vgl. Joachim Rohlfes, Geschichte und ihre Didaktik (Göttingen: 21997), S. 307. Insofern verfolgt die Arbeit einen handlungsorientierten Ansatz – auch wenn der Ausdruck im Titel bewusst vermieden wird, weil zu diskutieren sein wird, ob die gewählten Aktionsformen dies im engeren Sinne sind –, denn „Handlungsorientierung“ in einem weiteren Sinn impliziert auch die Handlungen ermöglichende Dimension, und der Museumsbesuch soll sich als lebensbedeutsam erweisen und die Schüler zum touristischen Handeln für die Zeit nach der Schule befähigen.
[6] Vgl. z. B. Petra Gerster, Christian Nürnberger, Erziehungsnotstand. Wie wir die Zukunft unserer Kinder retten (Berlin: 2001).
[7] So auch die Richtlinien und Lehrpläne, S. 28.
[8] Wittenbruch 1995, S. 122.
[9] An dieser Stelle wäre ein schulgeschichtlicher Exkurs zum Thema „Schulleben“ aufschlussreich. In der Antike z. B., als der Lehrer dem Banausen gleichgestellt war, wäre es undenkbar gewesen, dass er auch erzogen hätte. Von Dionysios II., dem gestürzten Tyrannen von Sizilien, wird gesagt, er sei am Ende noch Lehrer geworden, sozusagen als Tiefpunkt seines sozialen Abstiegs.
[10] Eugen Ruf, Sinnliche Erfahrung, gemeinsame Erlebnisse, S. 5, in: Karlheinz Burk, Claus Claussen (Hrsg.), Lernorte außerhalb des Klassenzimmers II. Methoden, Praxisberichte, Hintergründe (Frankfurt a. M.: 1981) (Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd. 49), S. 5-17.
[11] Vgl. Rohlfes 1997, S. 303.
[12] Vgl. etwa Detlef Hoffmann, Geschichtsunterricht und Museen, S. 490, in: Klaus Bergmann u. a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik (Seelze-Velber: 41992), S. 489-492.
[13] Vgl. Hans-Jürgen Pandel, Gerhard Schneider (Hrsg.), Handbuch Medien im Geschichtsunterricht (Schwalbach/Ts.: 1999), S. 509 f.
[14] Vgl. ebd., S. 512.
[15] Vgl. Hey 1978, S. 9.
[16] Vgl. Pandel und Schneider 1999, S. 513 und die dortige Anmerkung 10.
[17] Marie-Louise Schmeer-Sturm, Museumspädagogik. Geschichte, in: CD-Rom der Pädagogik (Hohengehren: 1996).
[18] Vgl. Heinrich Theodor Grütter, Geschichte im Museum, S. 708, in: Klaus Bergmann u. a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik (Seelze-Verlber: 51997), S. 707-713.
[19] Vgl. Hoffmann 1992, S. 489.
[20] Vgl. Grütter 1997, S. 707.
[21] Marc Bloch, Apologie der Geschichte oder Der Beruf des Historikers, hrsg. v. Lucien Febvre, aus dem Franz. übertr. v. Siegfried Furtenbach, rev. durch Friedrich J. Lucas (Stuttgart: 31992), S. 56 f.
[22] Vgl. ebd., S. 56.
[23] Unverständlich ist, warum Pandel und Schneider 1999, S. 513, gerade Bildquellen diese Funktion zuschreiben und sie v. a. auf diese Funktion beschränken, denn für Bildquellen dürfte das unter „Emanzipation“ Aufgeführte doch gleichermaßen wie für gegenständliche Quellen gelten.
[24] Vgl. Hey 1978, S. 23.
[25] Rohlfes 1997, S. 305.
[26] Hey 1997, S. 728.
[27] Hoffmann 1992, S. 490.
[28] Eva Sturm, Konservierte Welt Museum und Musealisierung (Berlin: 1991), S. 43.
[29] Ebd.
[30] Karl Pellens, Historisches Museum und Museumsdidaktik, S. 22, in: Wilhelm van Kampen, Hans Georg Kirchhoff (Hrsg.), Geschichte in der Öffentlichkeit. Tagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik vom 5. bis 8. Oktober 1977 in Osnabrück (Stuttgart: 1979) (Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, Bd. 23), S. 17-33.
[31] Rohlfes 1997, S. 307.
[32] Vgl. Hey 1978, S. 52.
[33] Vgl. Ingbert von Martial, Jürgen Bennack, Einführung in schulpraktische Studien. Vorbereitung auf Schule und Unterricht (Baltmannsweiler: 62000), S. 80 f.
[34] Martin Lenz-Johanns, Differenzen im Verhältnis von Schule und Museum?, S. 407, in: Klaus Weschenfelder, Wolfgang Zacharias, Handbuch Museumspädagogik. Orientierung und Methoden für die Praxis (Düsseldorf: 31992 (überarb. Neuaufl.)), S. 402-413.
[35] Ebd.
[36] Vgl. Ohde und Wiederhold 1994, S. 10.
[37] Johann Traugott Leberecht Danz, Über den methodischen Unterricht in der Geschichte auf Schulen (Leipzig: 1798), S. 65.
[38] Vgl. Hans-Jürgen Pandel, Quelleninterpretation. Die schriftliche Quelle im Geschichtsunterricht (Schwalbach/Ts.: 2000), S. 76 f.
[39] Vgl. Klaus Bergmann, Emanzipation, S. 238, in: Klaus Bergmann u. a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik (Seelze-Velber: 41992), S. 236-239.
[40] Ebd.
[41] Vgl. Hey 1978, S. 9.
[42] Hoffmann 1992, S. 491.
[43] Pellens 1979, S. 20.
[44] Vgl. ebd., S. 21.
[45] Ebd., S. 21. Pellens Bemerkungen beziehen sich allerdings auf das Jahr 1977. Zu fragen bleibt, ob sich das bis heute nicht doch erheblich verändert hat. Das Buch ist trotz seines Alters von Interesse, weil es aus der Zeit stammt, wo sich die Museumsdidaktik zu entwickeln begann.
[46] Vor diesem Hintergrund scheint Heys Aussage, die Exkursion – und damit nach seiner Begriffsbestimmung auch der Museumsbesuch – eigne sich besonders zum exemplarischen Arbeiten, nur bedingt Gültigkeit zu haben (vgl. Hey 1978, S. 13).
[47] Vgl. Pellens 1979, S. 21.
[48] Pandel 2000, S. 191.
[49] Vgl. z. B. Rohlfes 1997, S. 303, oder Hey 1978, S. 14 f. Allerdings bedacht werden sollte, dass sich gegenständliche Quellen dadurch gegenüber schriftlichen auszeichnen, dass sie anders als Texte nicht linear strukturiert sind und nicht nur einen Zugriffspunkt haben, nämlich den Textanfang.
[50] Vgl. Hey 1978, S. 71.
[51] Beispiel entnommen aus Pandel und Schneider 1999, S. 514. Das Museum erweist sich gegenüber von Schülern mitgebrachten Objekten insofern als vorteilhaft, als es zumeist die Datierung, die Herkunft und die Funktion des Objektes gesichert angeben kann.
[52] Vor dem Hintergrund der Relevanz von Emotionen gerade im Geschichtsunterricht erscheint folgende Bemerkung von Rohlfes geradezu abwegig und elitär, mit der er sich gegen Walter Benjamins Auffassung wendet, Objekten sei eine „Aura“ eigen: „Insofern darf der handfeste Ertrag von Besichtigungen nicht zu hoch veranschlagt werden. Der nicht-professionelle Betrachter (nur von diesem ist die Rede) trägt oft nicht mehr als ungefähre Eindrücke und pauschale Vorstellungen mit nach Hause und mag sich, wenn es hochkommt, von der schwer auf den Begriff zu bringenden Aura des Historischen angerührt fühlen“ (Rohlfes 1997, S. 303). Überboten wird diese Aussage noch, wenn Rohlfes warnt, der normale Zuschauer laufe „Gefahr, von den vielen Eindrücken überwältigt zu werden“ (ebd., S. 306).
[53] Museumssuchmaschinen, mit denen man Museen in ganz Deutschland oder eingeschränkt auf einzelne Bundesländer und unter Angabe eines Stichwortes suchen kann, sind z. B. unter folgenden Internetadressen zu finden: <http://webmuseen.de> (22.03.05) und <http://www.museuminfonet.de> (22.03.05).
[54] Vgl. z. B. Hildegard Vieregg u. a. (Hrsg.), Museumspädagogik in neuerer Sicht. Erwachsenenbildung im Museum, Bd. 1, Grundlagen, Museumstypen, Museologie (Baltmannsweiler: 1994), S. 145-305.
[55] Vgl. Rohlfes 1997, S. 304. Zu diskutieren wäre, ob dort nur die politische Geschichte und allenfalls noch Gesellschaftsgeschichte ausgestellt wird, d. h. die „große“ Geschichte, die Welt-, Europa- und Nationalgeschichte. Damit ergäbe sich die Schwierigkeit, die großen historischen Zusammenhänge darstellen zu müssen und dass Geschichte dieser Art weniger anschaulich ist.
[56] Vgl. Hoffmann 1992, S. 489.
[57] Vgl. Rohlfes 1997, S. 303. Heinrich Theodor Grütter, „Geschichte im Museum“, S. 14, Geschichte lernen 14 (1990), S. 14-19, weist zurecht auf die Problematik dieser strikten Definition hin: Kunstgegenstände hätten in der damaligen Zeit einen höheren Gebrauchs- als Kunstwert gehabt haben können und auch ihren Status verlieren können, während Gebrauchsgegenstände in den Rang von Kunstgegenständen hätten aufsteigen können.
[58] Vgl. Hoffmann 1992, S. 489.
[59] Vgl. „Josef Albers Museum Quadrat“ <http://www.fh-bochum.de/fb1/af-iba/718af.html> (22.03.05).
[60] Hoffmann 1992, S. 490. Einen lebhaften Eindruck von der Diskussion in den 70er Jahren bietet Hey 1978, S. 81-83, insbesondere S. 81: „Viele tradierte Zeugnisse unserer Kultur sind so sehr von der Kunstgeschichte und den Kunsthistorikern mit Beschlag belegt worden, dass der Historiker sich kaum noch traut, mit seinen Fragestellungen an sie heranzutreten und sie als historische Quelle zu nutzen.“
[61] Vgl. Marie-Louise Schmeer-Sturm, Museumspädagogik. Lernbereiche und Methoden, in: CD-Rom der Pädagogik (Hohengehren: 1996).
[62] Zu diesen ganz praktischen Überlegungen finden sich nützliche Hinweise bei Karlheinz Burk, Claus Claussen, Auswertung der Umfrage „Lernorte außerhalb der Schule“, S. 166-178, in: Karlheinz Burk, Claus Claussen (Hrsg.), Lernorte außerhalb des Klassenzimmers II. Methoden, Praxisberichte, Hintergründe (Frankfurt a. M.: 1981) (Beiträge zur Reform der Grundschule, Bd. 49), S. 164-195; dort werden 8 Problemkreise außerschulischer Lernorte unterschieden, die Problemkreise „Unterrichtszeit“, „Wegstrecke/Transport“, „Disziplin“, „Kompetenz und Rolle des Lehrers“, „Struktur der didaktischen Situation am Lernort“, „Medien als Alternative zur Realbegegnung am Lernort“, „Schulorganisation“, „Lernorte außerhalb der Schule als historisches Relikt“.
[63] Die Wanderrichtlinien weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Kosten für Schulwanderungen und -fahrten möglichst niedrig zu halten sind (vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (Hrsg.), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften 2004/2005 (Düsseldorf/Frechen: 2004), S. 14/13, § 2.2.).
[64] Vgl. Ingrid Stahmer, Vorwort, S. 6, in: Schule und Museum. Vom Nutzen des Museums für die Schule. Anregungen für den Unterricht in den Fächern Geschichte, Deutsch, Physik, Bildende Kunst, Erdkunde/Sachkunde, hrsg. v. museumspädagogischen Dienst Berlin in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport und dem Außenamt der Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz (Berlin: 1998), S. 6.
[65] Der befürchtete Fall trat ein, denn der Bus geriet in einen Stau und hatte ungefähr eine halbe Stunde Verspätung. Für die vier Buskinder war das allerdings unproblematisch: E. ging zu Fuß nach Hause, S. und D. waren vorsorglich mit dem Fahrrad gekommen und S. wurde an diesem Tag von seinem Vater abgeholt.
[66] Die Schulverordnung fordert, die Aufsichtsmaßnahmen von der jeweiligen konkreten Situation abhängig zu machen (vgl. BASS, S. 12/3, § 12).
[67] Vgl. BASS, S. 14/14, § 5.2. u. 6.1.
[68] Vgl. R. Brauer u. a., Wortstark 5. Themen und Werkstätten für den Deutschunterricht (Hannover: 1996), S. 160.
[69] Vgl. z. B. Schreiber 1999, S. 33.
[70] Schreiber schlägt hingegen vor, „dem größten Rabauken die Kamera anzuvertrauen und ihm Dokumentationsaufgaben zu geben“ (ebd.).
[71] Kontrovers diskutiert wird in der Literatur, ob der Zeitdruck und Wettbewerb, wie er bei Museumsrallyes entsteht, einer intensiven Auseinandersetzung nicht entgegenwirkt (vgl. Andreas Urban, Geschichtsvermittlung im Museum, S. 378, in: Hans-Jürgen Pandel u. a. (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht (Schwalbach/Ts.: 2004), S. 370-387). Weil jede Gruppe unterschiedliche Arbeitsaufträge hatte und keine Wettbewerbssituation bestand, schien diese Gefahr gebannt zu sein.
[72] Vgl. Siegfried Rietschel, Museum und Schule, S. 154, 156 f., in: Thelma von Freymann (Hrsg.), Am Beispiel erklärt. Aufgaben und Wege der Museumspädagogik (Hildesheim u. a.: 1988) (Hildesheimer Beiträge zu den Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Studien, Texte, Entwürfe, Bd. 29), S. 153-160. Rietschel geht folglich davon aus, dass Sachquellen nur illustrierende Funktion haben. Aspekte, wie sie in Kapitel 2.2.2. (Kap. „Emanzipation“) angesprochen werden, liegen anscheinend außerhalb seines Blickfeldes. Bestätigt wird dieser Eindruck auf S. 159, wo Rietschel sagt, der Unterricht der Schule werde im Museum „mit Anschauungsmaterial in den Museen [gewürzt]“.
[73] Lenz-Johanns 1992, S. 413.
[74] Vgl. BASS, S. 14/13, § 1.
[75] Vgl. Richtlinien und Lehrpläne, S. 54, 62.
[76] Ebd., S. 72.
[77] Arbeitspläne für das Fach Geschichte-Politik, entsprechend den Richtlinien für den Lernbereich Gesellschaftslehre (Kamp-Lintfort: 1990) (unveröffentlicht, Archiv der Hauptschule am Niersenberg).
[78] Vgl. Richtlinien und Lehrpläne, S. 58. Das eigentliche Argument für Alltagsgeschichte, Geschichte „von unten“ zu betrachten, findet sich allerdings – vermutlich irrtümlicherweise – im Kapitel „Geschichte vor Ort“ (Kap. 4.3.).
[79] Vgl. G. Dellmann u. a., Wir und unsere Vergangenheit 1. Von der Vorgeschichte bis zur Demokratie der Griechen. 5. Klasse (Bochum u. a.: o. J.), S. 6. L. Frenken u. a., Durchblick. Geschichte/Politik 5/6. Hauptschule Nordrhein-Westfalen (Braunschweig: 2001), S. 42.
[80] Vgl. ebd., S. 59.
[81] Vgl. ebd., S. 41.
[82] Vgl. ebd., S. 54, 56 f.
[83] Ehrenfried Kluckert, Kunstführung und Reiseleitung. Methodik und Didaktik (Oettingen: 1981), S. 174.
[84] Urban 2004, S. 372-377 u. S. 377-380.
[85] Vgl. ebd., S. 380-384.
[86] Die Forderungen, die die psychologische Didaktik impliziert, finden sich konzise z. B. bei Hans Martin Trautner, Lehrbuch der Entwicklungspsychologie, Bd. 2, Theorien und Befunde (Göttingen: 1991), S. 226.
[87] Die Auffassung Matthes, Foto- oder Videoaufnahmen seien völlig ungeeignet, weil sie auch festhielten, was von Schülern nicht gesehen werde, ist in ihrer Schärfe sicher nicht zu halten, denn gerade im Unterricht kann man ja solche Details erst noch in den Aufzeichnungen entdecken; die Aussage gibt aber den durchaus nützlichen Hinweis, dass Umschreiben und Skizzieren u. U. eine höhere Verarbeitungsintensität der Schüler erfordern als das bloße Ablichten (vgl. Michael Matthes, Einführung, S. 13 f., in: Schule und Museum. Vom Nutzen des Museums für die Schule. Anregungen für den Unterricht in den Fächern Geschichte, Deutsch, Physik, Bildende Kunst, Erdkunde/Sachkunde, hrsg. v. museumspädagogischen Dienst Berlin in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport und dem Außenamt der Staatlichen Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz (Berlin: 1998), S. 9-19).
[88] Burk und Claussen 1981, S. 33.
[89] Ebd., S. 36.
[90] Vgl. Rohlfes 1997, S. 520.
[91] Vgl. Pandel und Schneider 1999, S. 580-590.
[92] Rohlfes 1997, S. 306.
Details
- Titel
- Der Museumsbesuch im Geschichtsunterricht: Den Alltag meistern in der Steinzeit - Unterrichtsgang der fünften Klasse einer Hauptschule zum Museum 'Quadrat' in Bottrop
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V297814
- ISBN (Buch)
- 9783956844690
- ISBN (PDF)
- 9783956849695
- Dateigröße
- 6219 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Exkursion außerschulischer Lernort Geschichtsdidaktik Museumspädagogik Geschichte
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2005, Der Museumsbesuch im Geschichtsunterricht: Den Alltag meistern in der Steinzeit - Unterrichtsgang der fünften Klasse einer Hauptschule zum Museum 'Quadrat' in Bottrop, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297814
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.