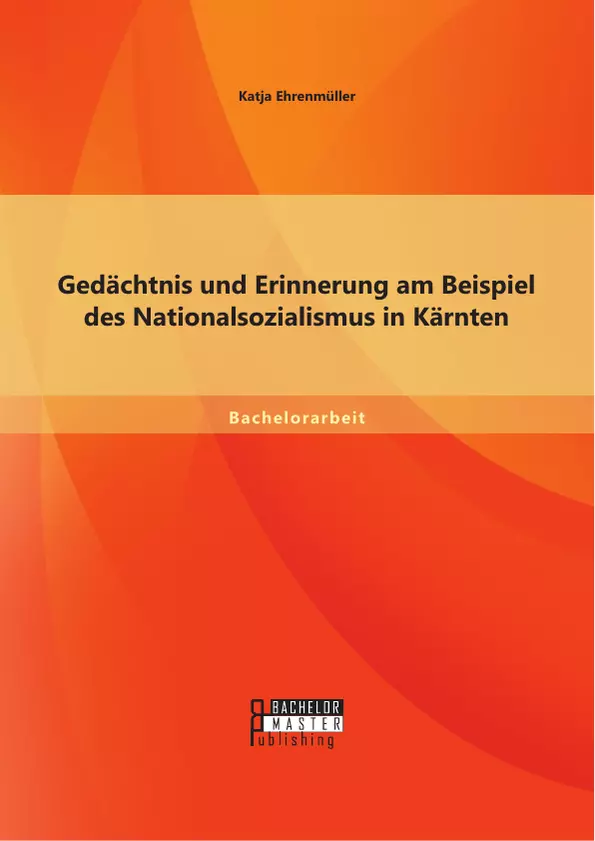Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos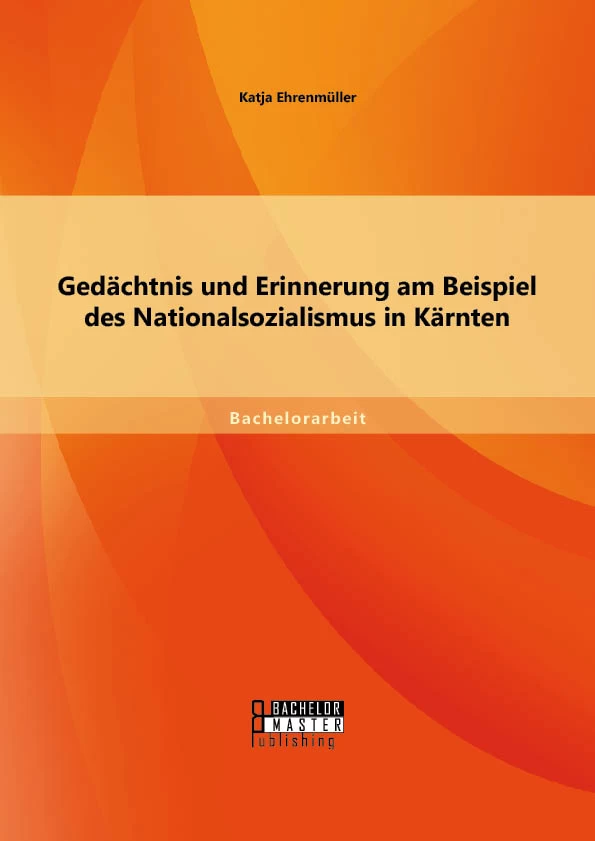
Gedächtnis und Erinnerung am Beispiel des Nationalsozialismus in Kärnten
Bachelorarbeit, 2013, 38 Seiten
Geschichte Europa - Deutschland - Nationalsozialismus, II. Weltkrieg
Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Note
1
Leseprobe
2.2. Kommunikatives und kulturelles Gedächtnis
Aleida und Jan Assmann entwickelten den Begriffs des Kollektivgedächtnisses von Halbwachs weiter und unterschieden zwischen zwei Typen: kommunikatives und kulturelles Gedächtnis. Das kommunikative Gedächtnis entsteht durch alltägliche und informelle Kommunikation mit anderen Individuen und ist gekennzeichnet durch Vergessen und Erinnern. Aleida und Jan Assmann bezeichnen es auch als „Alltagsgedächtnis“, denn aus der Alltagskommunikation entwickelt sich ein Gedächtnis, das, wie schon Halbwachs feststellte, sozial vermittelt und gruppenbezogen ist (siehe Kapitel 2.1). Das kommunikative Gedächtnis reicht höchstens biblische drei bis vier Generationen, also etwa 80 bis 100 Jahre zurück. Ein fixer Punkt in der Vergangenheit, an dem das kommunikative Gedächtnis beginnt, existiert nicht, denn der Zeithorizont entwickelt sich mit dem Fortschreiten der Gegenwart mit. Es entsteht mit seinen Trägern und wenn diese sterben, verschwindet es mit ihnen und macht Platz für ein neues Gedächtnis (vgl. Assmann/Assmann, 1988, S. 29–31).
Im Gegensatz dazu ist das kulturelle Gedächtnis gekennzeichnet durch Fixpunkte in der Vergangenheit: Ereignisse, die in der Erinnerung einer Gruppe erhalten bleiben. Es hat die Aufgabe, Erfahrungen und Wissen über Generationen hinweg zu bewahren und sozusagen ein soziales Langzeitgedächtnis zu schaffen. Dabei baut es auf externe Datenspeicher und Institutionen auf, die das Gedächtnis pflegen und Kenntnisse vermitteln (vgl. Assmann A., 2002, S. 189). Dieses Wissen hat identitätsstiftenden Charakter, denn Gruppen stützen sich darauf, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Dennoch liegt das kulturelle Gedächtnis nicht im Bereich der Alltagskommunikation, sondern im Bereich der objektivierten Kultur und der organisierten bzw. zeremonialisierten Kommunikation. Es ist gekennzeichnet durch Alltagsferne, denn der Zeithorizont wandert nicht wie beim kommunikativen Gedächtnis mit. Deshalb ist das kulturelle Gedächtnis auf Träger angewiesen, die sowohl in mündlichen als auch schriftlichen Gesellschaften existieren: Schamanen, Priester, Lehrer, Künstler, Gelehrte, Rabbis etc. Das kulturelle Gedächtnis wird erhalten in Artefakten, wie Texten, Bildern und Skulpturen, Architekturen und Landschaften, und in Ordnungen, wie Festen, Bräuchen und Ritualen (vgl. Assmann/Assmann, 1988, S. 30f.). Es ist die gespeicherte Erinnerung und wird erst mit Erscheinen des Mediums Schrift wirklich vom kommunikativen Gedächtnis trennbar. Bei nichtschriftlichen Gesellschaften ist es schwierig, die Unterscheidung zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis zu treffen, weil Stammesmythen, Initiationsriten, Feste und Heldenlieder ein Teil von beiden Formen sein können. In Schriftkulturen vermehrt sich das kulturelle Gedächtnis und nur Teile dieser sich vergrößernden Archive an Wissen werden gebraucht und bewohnt (vgl. Assmann, J., 2000, S. 199–213).
Aleida Assmann unterteilt das kulturelle Gedächtnis weiter in Speicher- und Funktionsgedächtnis. Sie bezeichnet „Speichern“ als ein „mechanisches Verfahren der Einlagerung und Rückholung“ (2001, S. 15). Es bezieht sich auf objektives Wissen, das erlernt werden kann. Das Speichergedächtnis umfasst die Sammlung, Konservierung und Aufbewahrung von Wissen. Es existiert in Form von Archiven, wie Museen oder Bibliotheken, und Denkmälern, welche die Medien des Speichergedächtnisses sind. Sie nehmen wissenschaftliches und historisches Wissen auf. Es handelt sich um kumuliertes Wissen, das von keiner einheitlichen Perspektive betrachtet wird. Das Funktionsgedächtnis trifft eine Auswahl aus dieser Informationsmasse, an die sich das lebendige Gedächtnis erinnern kann, schafft ein Identitätsangebot und bietet Orientierung. Diese Gedächtnisform betrachtet die Informationen von einem bestimmten Standpunkt, bewertet und ordnet sie. Laut Aleida Assmann gibt es drei Formen des kulturellen Funktionsgedächtnisses: den Kanon, das Museum und das Denkmal (vgl. ibd., S. 15–29). Speicher- und Funktionsgedächtnis können jedoch nicht strikt voneinander getrennt werden, denn Elemente des Funktionsgedächtnisses können wieder zurück in das Archiv des Speichergedächtnisses fallen bzw. umgekehrt daraus hervorgeholt werden (ibd., 2002, S. 190).
Für die Verbindung, aber auch die Trennung zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis greifen Aleida und Jan Assmann auf das Konzept der „floating gap“ von Vansina zurück (Assmann J., 2007, S. 48f.). Für die jüngste Vergangenheit finden sich zahlreiche Informationen, ebenso gibt es eine große Anzahl an Überlieferungen des Ursprungs aus frühen Perioden. Dazwischen existiert jedoch eine Zeit, zu der nur spärliche Informationen vorhanden sind. Diese mittlere Zeitperiode bezeichnet Vansina als „floating gap“ (1985, S. 23), die mit der Generationenfolge mitwandert.
2.3. Autobiografisches Gedächtnis
Harald Welzer greift bei seinen Überlegungen den Begriff des kollektiven Gedächtnisses von Halbwachs auf, ebenso den Gedächtnisbegriff bei Aleida und Jan Assmann sowie Untersuchungen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie. Biologische Reife, psychologische Entwicklung und soziale Umwelt spielen in seinen Überlegungen eine bedeutende Rolle für die Entwicklung des Gedächtnisses: Welzer spricht von einem autobiografischen Gedächtnis, das sich im sozialen Umfeld entwickelt (vgl. 2002a, S. 15ff.).
Welzer kritisiert den Begriff des Kollektivgedächtnisses von Halbwachs, denn er sei unscharf und ungenau. Anstatt von einem kollektiven Gedächtnis zu reden, solle dieses in verschiedene, differenzierte Gedächtnisformen gegliedert werden. Als eine teilweise gelungene Unterteilung des Gedächtnisses in verschiedene Formen sieht Welzer die Unterscheidung von individuellem, kollektivem, kulturellem und kommunikativem Gedächtnis bei Aleida und Jan Assmann. Laut Welzer ist diese jedoch noch immer unzureichend: Die Grenzen des kollektiven Gedächtnisses seien unscharf, das individuelle Gedächtnis sei ungenau definiert (vgl. 2002b, S. 230f.).
Gemäß Welzer geht der Gedächtnisbegriff von Aleida und Jan Assmann auf die kommunikative Praxis von Gruppen und Gesellschaften ein, nicht aber darauf, wie sich das kommunikative Gedächtnis auf Seite des Individuums verhält (2002a, S. 15). Er betrachtet dieses aus Sicht der Einzelperson und spricht von einem autobiografischen Gedächtnis, das sich durch soziale Interaktionen entwickelt und auch nur beim Kontakt zu anderen auflebt. Das autobiografische Gedächtnis hat die Aufgabe, unsere Erinnerungen anzuordnen und so zu beschreiben, dass sie dem gegenwärtigen Ich entsprechen (vgl. ibd., S. 208–222). Welzer geht von neurowissenschaftlichen Überlegungen aus und weist auf die zentrale Bedeutung von Emotionen für das Gedächtnis hin. Diese sind als Bewertungen zu sehen, die Erfahrungen mit Werten verbinden und erst dadurch subjektiv sinnvolles Handeln erlauben. Da diese Bewertungen vom Körper vermittelt werden, ist es notwendig, das individuelle Gedächtnis in Bezug auf die organischen Verbindungen zu betrachten. Gemäß Welzer müssen also neurowissenschaftliche Befunde berücksichtigt werden, um den Aufbau des Gedächtnisses zu begründen. Folglich hält er es für sinnvoll, zwischen einem bewussten – kulturellen – Gedächtnis und einem unbewussten – sozialen – Gedächtnis zu unterscheiden (vgl. ibd., 2002b, S. 230).
2.4. Formierung sozialer Gedächtnisse
Von einem sozialen Gedächtnis ist auch bei Gerd Sebald und Jan Weyand (2011) die Rede. Sie entwickelten eine relativ junge soziologische Theorie und sprechen von der Formierung sozialer Gedächtnisse. Sebald und Weyand gründen ihre Überlegungen unter anderem auf die Unterscheidung von kommunikativem und kulturellem Gedächtnis nach Aleida und Jan Assmann sowie die Betrachtung des Gedächtnisses in Bezug auf das Individuum nach Welzer. Sie bauen auf der Theorie der sozialen Rahmen und den Aspekten der Rekonstruktivität und Funktionalität von Halbwachs auf (vgl. Sebald/Weyand, 2011, S. 175-178.).
Sebald und Weyand definieren soziale Gedächtnisse als „das soziale Vermögen, Vergangenes gegenwärtig verfügbar zu halten bzw. zu machen“ (ibd., S. 174). Individuen und soziale Systeme können die Vergangenheit in der Gegenwart rekonstruieren. Dabei hängt die Erinnerung nicht nur vom rekonstruierten Bild der Vergangenheit ab, sondern auch von den sozialen Bedingungen der Gegenwart. Diese legen fest, wie sich Individuen und soziale Gruppen erinnern können. Sebald und Weyand bezeichnen die sozialen Bedingungen und den Prozess, diese zu strukturieren, als Formierung sozialer Gedächtnisse. Diese Theorie baut grundlegend auf Halbwachs auf, Sebald und Weyand kritisieren jedoch die Interaktionsbasiertheit in ihrer ursprünglichen Form: Diese sei in der modernen Zeit nicht mehr vertretbar. Als zentrales Problem sehen Sebald und Weyand die Annahme, dass die sozialen Rahmen des Gedächtnisses eine Folge der Interaktion in Kollektiven seien. Ursprünglich ermöglichten kollektive Erfahrungen sowie ähnliches Erleben und Handeln innerhalb einer sozialen Gruppe gesellschaftliche Integration. In der Moderne tritt an die Stelle dieser Ähnlichkeit von Ereignissen etwas anderes: Menschen als Funktionsträger fühlen sich voneinander abhängig und integrieren sich in der Gesellschaft aufgrund dieser gegenseitigen Abhängigkeit, die durch Medien, insbesondere durch Geld, vermittelt wird (vgl. ibd., S. 177f.). Soziale Beziehungen in der modernen Zeit sind laut Sebald und Weyand weniger an kulturelle, politische und gesellschaftliche Traditionen gebunden; Personen definieren sich viel mehr durch die Funktionen, in die sie integriert werden, wie Staatsbürger, Arbeitskraft und/oder Rechtsperson. Diese funktionale Differenzierung formt zahlreiche soziale Gedächtnisse in verschiedenen Gesellschaftsschichten, Handlungsbereichen und Milieus. Es kommt zu einer Pluralisierung der Lebensvorstellungen von Individuen und Gruppen, wodurch sich wiederum soziale Gedächtnisse formieren (vgl. ibd., S. 181). Deswegen vertreten Sebald und Weyand den Standpunkt, dass soziale Gedächtnisse in der Moderne nicht mehr nur durch Interaktion in kollektiven Gruppen entstehen können.
Die sozialen Bedingungen lassen sich nach ihrer Funktion in Variation und Selektion unterscheiden. Durch Variation können die Möglichkeiten an Verknüpfungen von Vergangenheit und Gegenwart vergrößert oder deren Struktur verändert werden. Durch Selektion werden Regeln zur Verknüpfung von Gegenwart und Vergangenheit geschaffen. Sie lässt bestimmte Verbindungen zu und schließt andere aus. Die Relevanz von Handlungen, Denkweisen und Sprechmustern ändert sich bei verschiedenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und bildet somit den Kern der Selektion. Die Veränderung der sozialen Bedingungen verstärkt sich durch den Wandel von Erfahrungshorizonten über die Generationen hinweg. Die Rekonstruktion von Gewesenem ist nach Sebald und Weyand auf Medien angewiesen, die an Vergangenes erinnern. Diese geben die Vergangenheit aber nicht neutral wieder, sondern formieren, selektieren und strukturieren sie neu. Soziale Gedächtnisse sind also von der Struktur der Medien abhängig. Wenn an etwas erinnert wird, tritt damit gleichzeitig die Frage nach der Authentizität dieser Erinnerung auf. Bei der Rekonstruktion der Vergangenheit wird versucht, Beweise für diese Authentizität vorzuweisen, mit dem Ziel, die Vergangenheit korrekt abzubilden. Da jedoch jede Erinnerung aus der Sicht der Gegenwart wiedergegeben wird, werden lediglich Konstrukte geschaffen. Erinnerungen werden auf diese Konstrukte hin abgeändert und formiert. Dieser Gegenwartsbezug führt auch dazu, dass bei Erzählungen und Diskursen die Erinnerungen variieren: Es kommt zu Neuinterpretationen, Umgestaltung und Veränderungen (vgl. ibd., S. 180–186).
Sebald und Weyand führen die Überlegungen bezüglich kollektivem, kulturellem, kommunikativem und autobiografischem Gedächtnis weiter. Sie versuchen, diese an veränderte Bedingungen in der Moderne anzupassen und begründen die Bezeichnung der Formierung sozialer Gedächtnisse.
2.5. Erinnerungsorte
Wie schon zuvor Halbwachs beschäftigt sich Pierre Nora mit dem Gegensatz von Gedächtnis und Geschichte. Aufbauend auf diesen Überlegungen entwickelte er den Begriff der Erinnerungsorte. In dem fließenden Übergang, wo das Gedächtnis endet und die Geschichte beginnt, entsteht gemäß Nora das Bedürfnis nach Gedächtnisorten (1998, S. 11). Das französische Wort mémoire bezeichnet sowohl das Gedächtnis als auch die Erinnerung. Deshalb werden die Begriffe Erinnerungsort und Gedächtnisort in dieser Arbeit als Synonym verwendet, um die Bezeichnung lieux de mémoire, die Nora verwendet, im Deutschen auszudrücken.
Nora vertritt die These, dass Gedächtnis und Geschichte gegensätzliche Begriffe sind (ibd., S. 13f.). Das Gedächtnis ist ein Teil lebendiger Gruppen, repräsentiert somit das Leben und stiftet den Zusammenhalt in dieser Gruppe. Es ist ein ständiger Prozess von Erinnern und Vergessen, wie auch schon Aleida und Jan Assmann feststellten (Assmann, 1988, S. 10). Erinnerungen können für lange Zeit verschwinden und dann wieder hervortreten. Das Gedächtnis ist aktuell und affektiv, es trifft eine Auswahl an Einzelheiten. Es wird erkennbar am Konkreten, an Gesten, Bildern und Gegenständen. Die Geschichte hingegen bezeichnet gemäß Nora die lückenhafte Rekonstruktion des Vergangenen. Dabei fordert sie eine Analyse und kritische Auseinandersetzung und ist charakterisiert durch eine gewisse Universalität. Sie setzt sich mit zeitlichen Kontinuitäten, Entwicklungen und Beziehungen der Dinge auseinander (vgl. Nora, 1998, S. 13f.). „Die Geschichte ist die Entlegitimierung der gelebten Vergangenheit“, wie Pierre Nora es ausdrückt (ibd., S. 14).
Laut Nora bezeichnet der Begriff des Gedächtnisses, wie er heute verwendet wird, kein Gedächtnis mehr, sondern bereits Geschichte. Er unterscheidet zwischen dem wahren Gedächtnis, das heute nur noch in alltäglichen Gesten und Gewohnheiten zu erkennen ist, und dem verwandelten Gedächtnis, das schon in die Geschichte übergeht. Letzteres hat nichts mehr mit dem wahren Gedächtnis gemein. Nora beschreibt das verwandelte Gedächtnis als individuell und nicht mehr spontan, sondern als bewusst und als Pflicht erlebt. Es wird nicht mehr von innen her erlebt, sondern archiviert und registriert: Archive übernehmen die Aufgabe, Informationen zu speichern und Ereignisse festzuhalten. Was als Gedächtnis bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eine riesige Menge an Informationen, zu groß für einen Menschen oder eine Gesellschaft, um sich daran zu erinnern (vgl. Nora, 1998, S. 21–23).
Nora zufolge entsteht das Interesse an Gedächtnisorten erst durch den Bruch zwischen Gedächtnis und Geschichte: „Es gibt lieux de mémoire, weil es keine milieux de mémoire mehr gibt“ (1998, S. 11; Hervorhebung i. O.). Ein Bewusstsein erwacht, dass das Gedächtnis nicht mehr im gleichen Sinne weiterbesteht. Die Gesellschaft entfernt sich immer mehr von den erlebten Traditionen, Brauchtümern und Überlieferungen. Die Umgebung, in der sich das Gedächtnis entwickelte und Erinnerungen erlebt wurden (milieux de mémoire), veränderte sich stark und existiert nicht länger in der gleichen Weise. Was einst Teil des gelebten Gedächtnisses war, wird zur Geschichte. In dem Augenblick, in dem dieses Bewusstsein erwacht, versucht die Gesellschaft, an der Vergangenheit festzuhalten: Es entstehen Gedächtnisorte (lieux de mémoire).
Als Grund für den Zusammenbruch des Gedächtnisses, wie die Menschen es kannten, sieht Nora das Phänomen der Demokratisierung und Vermassung sowie die Gegebenheit, dass jedes Ereignis zum Welt- und Mediengeschehen werden kann. Diese Veränderungen führten auch zum Ende der Gedächtnisgesellschaften und der Gedächtnisideologien. Diese Gedächtnisgesellschaften, wie Kirche, Schule, Familie oder Staat, bewahrten die Werte und gaben sie weiter. Die Gedächtnisideologien regelten den Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft, indem sie festhielten, was aufzubewahren ist. Diese Zerrüttung des Gedächtnisses führte schließlich zur Trennung von Geschichte und Gedächtnis. Würde der Mensch noch das Gedächtnis bewohnen, es also unvermittelt und individuell erleben, wäre es nicht notwendig, Gedächtnisorte zu kreieren. Sobald jedoch eine Distanz existiert und das Bedürfnis nach Vermittlung besteht, handelt es sich nicht mehr um Gedächtnis, sondern um Geschichte und der Mensch entwickelt das Bedürfnis nach Erinnerungsorten (vgl. ibd., S. 11–14).
Gedächtnisorte könnten als Schnittpunkt zwischen Geschichte und Gegenwart verstanden werden. Nora sieht diesen gekennzeichnet durch zwei Bewegungen: Die Geschichte verändert sich in dem Sinne, dass Menschen über sie nachdenken, und es endet eine Gedächtnistradition. Die Erinnerungsorte entstehen einerseits durch den Willen, ein Ereignis im Gedächtnis festzuhalten, und andererseits einer gewissen Ferne zu diesem Ereignis und dem Bewusstsein einer Vermittlungsnotwendigkeit. Nora sieht den Moment der Gedächtnisorte dort, wo das Gedächtnis nicht mehr gelebt, sondern dieses studiert wird. Sie sind unbewohnte Orte, die auf eine Welt verweisen, zu der die Menschen nur noch eine zufällige Beziehung haben. Erst durch die immer minderwertigere Rolle von Ritualisierung entsteht der Begriff der Gedächtnisorte. Sie sind Reste, in denen ein Bewusstsein die Geschichte überdauert. Sie entstehen aus dem Gefühl heraus, dass es kein spontanes Gedächtnis mehr gibt und es notwendig ist, Archive zu schaffen, Jahrestage zu begehen und Feiern zu organisieren – also das Gedächtnis festzuhalten (vgl. ibd., S. 18–21).
Gemäß Nora besitzen Erinnerungsorte einen materiellen, funktionalen und symbolischen Sinn, also eine vergegenständlichte Form, eine soziale oder politische Funktion und eine symbolische Bedeutung. Diese Aspekte sind jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt und existieren neben- und miteinander. Als Beispiel verwendet Nora den Begriff der Generation: Er ist materiell aufgrund des demographischen Inhalts und funktional, weil er zur Weitergabe von Erinnerungen führt. Sein symbolischer Sinn besteht darin, dass ein Ereignis, das nur eine gewisse Gruppe an Menschen erlebt hat, eine Mehrheit charakterisiert, die nicht daran teilnahm (vgl. ibd., S. 32f.).
Gedächtnisorte gehören laut Nora sowohl zur Geschichte als auch zum Gedächtnis. Dadurch ist es möglich, Erinnerungsorte in einer unbestimmten Menge an Orten zu erkennen. Eine Klassifizierung hält Nora für schwierig, denn sie kann unendlich fortgesetzt werden. Trotzdem zeigt er anhand einiger Beispiele, dass diese möglich ist und dass eine unbewusste Organisation des kollektiven Gedächtnisses existiert (vgl. ibd., S. 40).
Erinnerungsorte können geografische Orte sein, wie z. B. Museen, Friedhöfe oder Gedenkstätten. Diese sind durch ihre Lokalisierung an einem Ort bestimmt. Museen oder Friedhöfe werden durch natürliche und konkrete Erfahrungen zu Gedächtnisorten. Sie sind funktional betont, weil sie diese Ereignisse zu bewahren versuchen. Gedenkstätten definieren sich als Gedächtnisorte aufgrund ihrer inneren Bedeutung. Nicht nur topografische Orte, sondern auch Ereignisse, können zu Erinnerungsorten werden. Dafür nennt Nora zwei verschiedene Möglichkeiten: Einerseits gibt es Ereignisse, die zum Zeitpunkt ihres Geschehens klein waren, aber von späteren Generationen als besonders bedeutsam erkannt werden, weil sie eine neue Zeit einleiten; andererseits existieren jene, die bereits zum Zeitpunkt des Geschehens einen großen symbolischen Sinn tragen. So sind gewisse Jahrestage durch konkrete Erfahrungen gekennzeichnet, die sie zu Gedächtnisorten machen. Auch Begriffe, wie die Generation, können zu Gedächtnisorten werden. Jede Verfassung und jedes diplomatische Abkommen kann ein Erinnerungsort sein, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Geschichtsbücher sieht Nora nur dann als Gedächtnisorte an, wenn sie mit einer großen Veränderung des Gedächtnisses einhergehen. Als Erinnerungsort mit vorübergehendem pädagogischem Existenzgrund nennt er z. B. Lehrbücher, Wörterbücher oder Testamente – sie haben vor allem funktionalen Charakter. Es gibt auch reine Erinnerungsorte, wie Grabreden, die nur in ihrer Gedenkfunktion existieren. Ein weitere wichtige Kategorie sind Gedächtnisorte mit rein symbolischer Bedeutung, wie die Nationalflagge, Festkalender oder Wallfahrten (vgl. ibd., S. 36ff.) Eine Gemeinsamkeit all dieser Orte ist, dass sie keine Referenten in der Gegenwart haben: Sie sind „Zeichen, die auf sich selbst verweisen“ (Nora, 1998, S. 40).
Wie eben beschrieben entwickelten Wissenschaftler aufbauend auf Halbwachs verschiedene Theorien, welche unterschiedliche Formen des Gedächtnisses und den Gegensatz von Gedächtnis und Geschichte behandeln. In den Kapiteln 3 und 4 wird am Beispiel des Nationalsozialismus in Kärnten gezeigt, welche Rolle diese Gedächtnisformen, sozialen Rahmen und Bedingungen sowie Gedächtnisorte für die Erinnerung einer Gesellschaft spielen.
3. Erinnerung an den Nationalsozialismus in Kärnten
Je größer die zeitliche Distanz zu den Geschehnissen aus der Zeit des Nationalsozialismus wird, umso mehr scheint auch das Bedürfnis nach Erinnerung zu wachsen. Organisationen, Initiativen und auch Einzelpersonen setzen sich für die Errichtung von Gedenkstätten ein, damit die Schrecken des Nationalsozialismus in Kärnten nicht vergessen werden: der Völkermord an Juden, Sinti und Roma oder die Morde an Behinderten, Homosexuellen, Alten, Kranken, Widerstandskämpfern und vielen anderen Gruppen, die nicht in das Konzept der Nationalsozialisten passten oder sich dagegen wehrten (Gstettner, 2009, S. 11f.). Orte, an denen NS-Verbrechen stattgefunden haben, werden nicht automatisch zu Gedächtnisorten. Sie unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht von anderen Plätzen. Erst wenn sich Menschen mit der Geschichte dieser Orte auseinandersetzen und sie Teil des Gedächtnisses werden, werden sie zu Erinnerungsorten. In diesem Kapitel werden bekannte und weniger beachtete Gedenkstätten und Orte der Erinnerung in Kärnten aufgezeigt, die bereits Teil des Gedächtnisses der Kärntner Gesellschaft sind oder noch werden können.
[...]
Details
- Titel
- Gedächtnis und Erinnerung am Beispiel des Nationalsozialismus in Kärnten
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V297697
- ISBN (Buch)
- 9783956842696
- ISBN (PDF)
- 9783956847691
- Dateigröße
- 674 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Maurice Halbwachs Aleida und Jan Assmann Pierre Nora Gedächtnistheorie Gedächtnisbegriff
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2013, Gedächtnis und Erinnerung am Beispiel des Nationalsozialismus in Kärnten, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297697
- Angelegt am
- 29.4.2015
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.