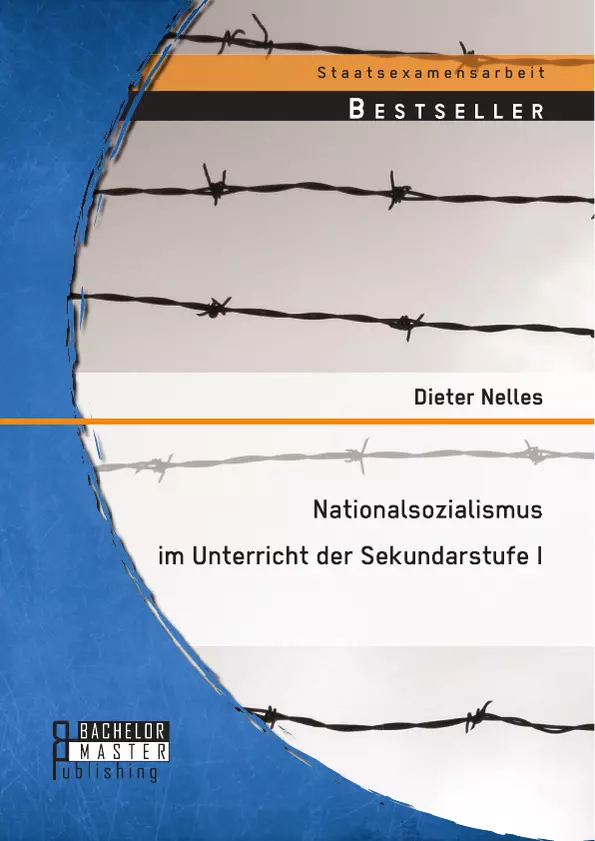Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos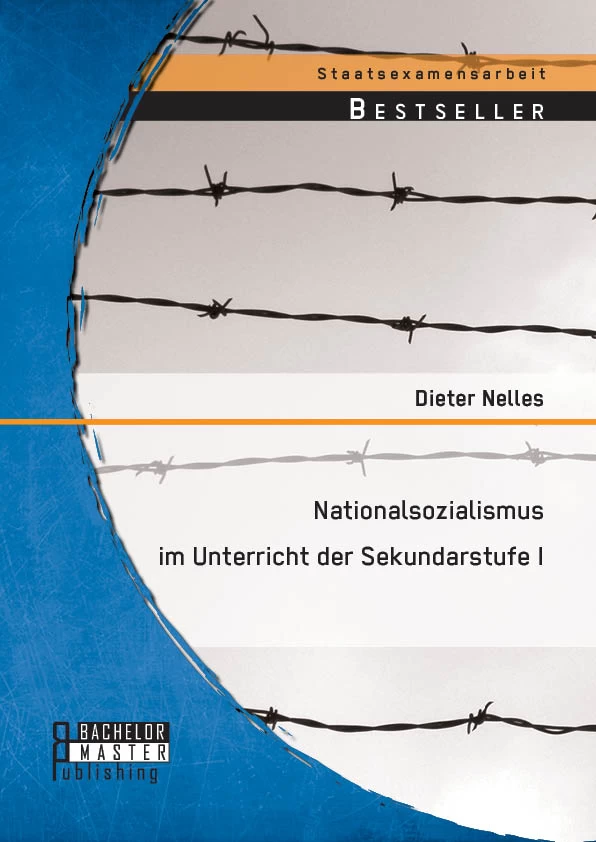
Nationalsozialismus im Unterricht der Sekundarstufe I
Examensarbeit, 2006, 38 Seiten
Autor

Kategorie
Examensarbeit
Institution / Hochschule
Note
1
Leseprobe
2.1. Lerngruppe und Unterrichtsverlauf
Außer wenigen Hospitationsstunden waren mir die Schüler der Klasse 9b nicht bekannt. Die Klasse besuchen 30 Schüler, von denen 16 migrantischer Herkunft sind: Türkei 6, Ukraine 3, Russland 2, Eritrea 1, Marokko 1, Serbien 1, Sri Lanka 1, Tunesien 1. Die Schüler hatten mit Ausnahme einer Doppelstunde anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht das Thema Nationalsozialismus im schulischen Unterricht noch nicht behandelt.
Als Einstieg in die Unterrichtsreihe wählte ich Bilder des durch Bombenangriffe zerstörten Elberfelder Rathauses und des Hauptbahnhofs und verband dies mit der Frage, was die Schüler über diese Bilder wissen und was sie beim Anblick solcher Bilder denken und fühlen. Die Beantwortung dieser und der Frage, was sie sonst noch über die Zeit von 1914-1945 wissen, zeigte, dass fast alle Schüler, wenn auch nicht detailliert, etwas über den Zweiten Weltkrieg wussten. In Absprache mit den Schüler, die Fragen zur Unterrichtsreihe aufschreiben sollten, wurden folgende Leitfragen für die Unterrichtsreihe formuliert: In welchem Land lebten unsere Vorfahren vor dem Ersten Weltkrieg? Warum brach der Erste Weltkrieg aus? Wer kämpfte gegen wen? Wie wurde gekämpft? Wie ging die Kaiserzeit zu Ende? Wie entstand die NSDAP? Warum hassten die Nazis die Juden? Wie kam es zum Rassismus? Wie kam Hitler zur Macht? Wie kam es zum Zweiten Weltkrieg?
Als Einstieg in das Thema Erster Weltkrieg sollten die Schüler, ihre Eltern fragen, wo ihre Groß- und Urgroßeltern von 1914-1945 gelebt hatten. Die Besprechung des Themas zeigte, dass der Erste Weltkrieg im familiären Gedächtnis kaum noch präsent ist, da nur ganz wenige Schüler wussten, in welcher Armee ihre männlichen Vorfahren gekämpft hatten. Auch die Staatenwelt vor 1914 war fast allen Schülern unbekannt. Zur Bearbeitung der Fragen hinsichtlich des Ersten Weltkrieges fertigten die Schüler in Gruppenarbeit politische Landkarten von Europa an, auf denen später die militärischen Bündnisse als auch der Frontverlauf eingetragen wurden. Diese Karten ermöglichten im Unterricht einerseits die Veranschaulichung der Kriegsziele der einzelnen Staaten als auch den Vergleich zur europäischen Staatenwelt in der Zwischenkriegszeit, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Veränderung der politischen Geographie Europas nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten 1989.
Das massenhafte Sterben in einem industrialisierten Krieg und die damit verbundene Entwertung menschlichen Lebens problematisierte ich über Bilder von Otto Dix, die von den Schülern interpretiert wurden. Ferner zeigte ich den Film „Im Westen nichts Neues“ von Lewis Milestone von 1930 nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Der Film hatte bei einigen Schülern eine andere Wirkung als von mir erwartet. Während ich als Jugendlicher die Darstellung des massenhaften Sterbens durch Gas und Stellungskrieg als sehr abschreckend empfand, bemerkte dazu ein Schüler, im Vergleich zu Schindlers Liste sei der Film „harmlos“. Was die Schüler am meisten bewegte, waren die Szenen zu Anfang und Ende des Films, in denen der Lehrer Kantorek die jungen Gymnasiasten aufforderte, sich freiwillig an die Front zu melden und davon sprach, wie süß und ehrenvoll es sei, für das Vaterland zu sterben.[1]
Der Film diente gleichzeitig als Übergang zur Weimarer Republik. Nach einer Kampagne der Nationalsozialisten, die den Film als Machwerk der „jüdisch-bolschewistischen Unterwelt“ diffamierten und die Premiere in einem Berliner Kino massiv störten, verbot die Filmoberprüfstelle die weitere Aufführung des Films wegen „Gefährdung des deutschen Ansehens im Auslande“. (vgl. Schrader: 134f., 154f.). Anhand von zwei zeitgenössischen Zeitungsartikeln wollte ich den Schülern exemplarisch die Wirkung der „Dolchstoßlegende“ nahe bringen, die wie kaum eine andere Parole der Deutschnationalen und Nationalsozialisten zur Zerstörung der Weimarer Republik und zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beigetragen hat.[2]
Zeitgleich zur Unterrichtsreihe wurde in der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Wuppertal die Ausstellung „Vor aller Augen“ gezeigt. Auf 120 Fotos dokumentiert sie den Terror der Nationalsozialisten in der Provinz. Die Fotos zeigen den Terror der SA und SS gegen Angehörige der Arbeiterbewegung in der Frühphase der NS-Diktatur, die Deportation deutscher Juden vor den Augen von Schulkindern und Passanten, das Anprangern und Kahlscheren von Frauen auf öffentlichen Plätzen, Propaganda- und Boykottaktionen von SA und SS gegen jüdische Geschäfte und viele andere Szenen, in denen Menschen vor aller Augen bloßgestellt und gedemütigt, bedroht, verhaftet und abtransportiert wurden.[3]
Als Hausaufgabe sollten die Schüler ein Foto beschreiben und ihre Eindrücke schildern. An die Inhalte der Ausstellung anknüpfend bearbeite ich mit den Schülern die Frage, gegen wen sich die Gewalt der Nationalsozialisten richtete: zunächst nach „innen“, d.h. gegen die politischen Gegner (Sozialdemokraten, Kommunisten, etc.) und gegen die ihrer Ansicht nach „rassisch Minderwertigen“ (Juden, Behinderte, Sinti und Roma) und dann nach Entfesselung des Zweiten Weltkrieges nach „außen“. Den zentralen Zusammenhang zwischen Rassismus einerseits und Gewalt andererseits behandelte ich exemplarisch am Krieg gegen die Sowjetunion. Anhand von mehreren Quellentexten erarbeiteten die Schüler die wesentlichen Aspekte des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion unter der Leitfrage: Was unterschied den Ersten vom Zweiten Weltkrieg.
Es blieb keine Zeit mehr auf den Zusammenhang zwischen Vernichtungskrieg und Holocaust einzugehen, da die Schüler ein Praktikum antraten. Dies wird von der verantwortlichen Kollegin zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
2.2. Reflexion
Zum Abschluss der Unterrichtsreihe stellte ich den Schüler drei Fragen, die sie schriftlich beantworten sollten: 1. Was hat Dir an der Unterrichtsreihe gut gefallen? Was hätte Deiner Meinung nach anders bearbeitet werden können? Findest Du, dass das Thema Nationalsozialismus auch noch für die heutige Zeit von Bedeutung ist?
Viele Schüler äußerten sich positiv zum Film „Im Westen nichts Neues“ und zum Besuch der Ausstellung sowie allgemein, etwas über Hitler und den Ersten und Zweiter Weltkrieg gelernt zu haben. Die meisten Schüler hätten sich eine detaillierte Darstellung des Nationalsozialismus, der Person Hitlers, des Zweiten Weltkrieges und der Judenverfolgung gewünscht. Eine Minderheit vertrat die Auffassung, das Thema habe heutzutage keine große Relevanz. Die anderen Schüler äußerten sich folgendermaßen: Das Thema sei relevant, weil: Kinder und Jugendlichen lernen sollten, wie grausam Kriege sind; es auch heute noch Rassisten und Nazis gebe; man wissen müsse, was die „Vorfahren“ anderen Menschen angetan hätten; man die Vergangenheit seines Landes nicht vergessen sollte; der Zweite Weltkrieg die Welt verändert habe und in Reaktion darauf die Vereinten Nationen gegründet worden seien.
Die Antworten der Schüler – soweit sie verallgemeinerbar sind -, zeigen, dass fast allen die öffentliche Bedeutung der NS-Geschichte durch Massenmedien bekannt ist. Gleichzeitig spiegeln die Antworten ihre Auseinandersetzung mit dem Thema als auch die Pluralität ihrer Geschichtsbezüge wider. Im Vergleich zu anderen historischen Themen waren die Motivation und die Mitarbeit der Schüler im Unterricht relativ hoch, wenn auch bei einigen nur punktuell in einzelnen Stunden. Das größte Interesse fand bei den Schülern der Besuch der Ausstellung. Dies dokumentieren ihre schriftlichen Ausarbeitungen, in denen sie ein Foto beschreiben und ihre Eindrücke schildern sollten.
Die öffentliche Demütigung von „Rasseschändern“ hinterließ bei vielen Schülern den größten Eindruck.[4] Dies hätte ich im Unterricht vertiefen sollen, um auf Basis der Fotos und schriftlichen Ausarbeitungen der Schüler exemplarisch die Täter-, Mitläufer- und Opferperspektive zu thematisieren und die nationalsozialistische Rassenpolitik zu vertiefen. Jedoch wäre dann die Behandlung des Zweiten Weltkrieges nicht mehr möglich gewesen. Dass ich mich für die letztere Variante entschieden habe, sehe ich rückblickend kritisch.
Bei der Bearbeitung der Quellentexte hatte ein großer Teil der Schüler Schwierigkeiten. Dies lag zum einen daran, dass ich deren Lesefähigkeit überschätzt habe. Zum anderen, dass der Einsatz von Quellen, so wichtig er im historischen Unterricht ist, viele Schüler überfordert, da die Quelleninterpretation sehr viel Einüben verlangt.
Hinsichtlich des Gegenwartsbezugs des Themas für die Schüler stellte ich eine Diskrepanz zwischen ihren schriftlichen und mündlichen Äußerungen fest. Mein Eindruck war, dass die meisten Schüler ihre Gedanken dazu nicht vor der Klasse äußern und diskutieren wollten. Als ein Schüler bemerkte, er sei schon mehrere Male bei Konflikten mit Gleichaltrigen anderer ethnischer Herkunft als „Nazi“ beschimpft worden, entstand auf meine Frage an die Klasse, ob sie ähnliche Situationen kennen, keine Diskussion. Nur ein Schüler ukrainischer Herkunft bemerkte zaghaft, er würde bei Besuchen in der Ukraine öfters gefragt, wie es ihm im „Faschistenland“ ergehe. Es bleibt im höchsten Maße spekulativ dieses Verhalten der Schüler zu interpretieren, wenn man sie erst einige Wochen kennt. Aus pädagogischem Takt hielt ich es in diesem Fall für geboten, nicht näher auf der Frage zu insistieren.
Insgesamt betrachtet, habe ich die Unterrichtsreihe zu „groß“ dimensioniert. Ich hätte mich stärker auf einzelne Aspekte konzentrieren müssen, um den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler gerecht zu werden. Leistungsstärkere Schüler hätten in Referaten weitergehende Aspekte bearbeiten können. Als inhaltlicher Zugang hätte eine stärker biographische Orientierung den Interessen der meisten Schüler entsprochen.
3. Schule und Nationalsozialismus
3.1. Bedingungen
3.1.1. Nationalsozialismus und Familiengedächtnis
In einer viel beachteten qualitativen Mehrgenerationenstudie hat eine Forschergruppe um den Essener Sozialpsychologen Harald Welzer (2002) festgestellt, dass in Deutschland heutzutage eine große Diskrepanz zwischen dem Familiengedächtnis (kommunikatives Gedächtnis) und der offiziellen Erinnerungskultur (kulturelles Gedächtnis) über den Nationalsozialismus besteht.[5] Während die offizielle Erinnerung weitgehend von den Verbrechen und dem Holocaust bestimmt sei, habe diese im Familiengedächtnis nur eine marginale Bedeutung. Besonders die Enkelgeneration neige dazu, die in der Familie erzählten Geschichten zu Erzählungen von widerständigen Verhalten umzudeuten. Nazis sind dabei immer die anderen, aber nicht die Mitglieder der eigenen Familie. Diese Tendenz der „kumulativen Heroisierung“ der eigenen Familienmitglieder ist, wie eine repräsentative Bevölkerungsumfrage bestätigt, am stärksten bei den Befragten mit den höchsten Bildungsabschlüssen ausgeprägt, d.h. bei denjenigen, die eigentlich am besten über die NS-Verbrechen aufgeklärt sein müssten.
Dieser paradoxe Effekt zeigt, dass auf der Ebene des kommunikativen Gedächtnisses eine andere Sicht auf die Geschichte besteht als auf der des kulturellen Gedächtnisses. Kommunikativ tradierte Gewissheiten und kognitiv repräsentiertes Wissen stellen unterschiedliche Bereiche des Geschichtsbewusstseins dar, die unverbunden nebeneinander existieren können, aber auch Verbindungen eingehen, wie die kumulative Heroisierung. Der Holocaust, fasst Welzer seine Forschungen zusammen, habe „seinen Ort in dem kognitiven Universum dessen, was man über Geschichte weiß, nicht in Familiengeschichten“. Er habe keinen „systematischen Platz im deutschen Familiengedächtnis“, das, so seine These „die primäre Quelle für das Geschichtsbewusstsein ist“ (Welzer 2004: 60).
Ob man diese Befunde, wie Welzer, als „Kollateralschaden der Geschichtsaufklärung“ deutet oder wie andere Autoren als Erfolg einer Pädagogik, bei der die Identifikation mit den Opfern und das Vorbild des Widerstands im Vordergrund steht und auf diesem Hintergrund, die Geschichtsverfertigung der Jugendlichen „auch als Bewältigung einer kognitiven Dissonanz“ interpretiert, ist eine offene Frage (Meseth u.a. 2004a: 22). Fest steht aber, dass die emotionalen Dimensionen der Vergangenheitsvorstellungen, die außerhalb des schulischen Unterrichts erzeugt werden, bislang stark unterschätzt worden sind und die Ergebnisse Welzers eine große Herausforderung für die Geschichts- und Politikdidaktik bilden.
Auch dann, wenn man einschränkend bemerken muss, dass die Schüler, die gegenwärtig in der Sekundarstufe I mit dem Thema Nationalsozialismus konfrontiert werden, nur noch in den wenigsten Fällen zur „Enkelgeneration“ – gezählt nach den Tätern – gehören. Eine persönliche oder affektive Beziehung zu den Urgroßeltern dürfte nur in den seltensten Fällen bestehen und dies macht einen beträchtlichen Unterschied zu den vorhergehenden Generationen aus. Nach neueren Untersuchungen des Hamburger Geschichtsdidaktikers Bodo von Borries (2005) reagieren immer mehr Jugendliche zunehmend aggressiv „gegen die Feststellung der eigenen Abstammung aus der ,Tätergesellschaft’“ (ebd.: 45). Er rechnet mit einer Umkehrung der Argumentation aus den 1960er und 1970er Jahren. „Während damals Verstrickungen der eigenen Familie tendenziell akzeptiert und zur Waffe im Generationenkonflikt wurden, wird heute eine solche unmittelbare Verantwortlichkeit zunehmend geleugnet.“ (v. Borries 2004a.: 68).
3.1.2. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland
Macht schon die Generationenfolge einen neuen didaktischen Zugriff nötig, so gilt dies erst recht für die zunehmend größer werdende Zahl von Lernenden mit Migrationshintergrund, deren Vorfahren größtenteils weder Opfer des NS-Regimes waren noch Täter, Mitläufer oder Zuschauer. Bislang wissen wir nur wenig darüber, wie sich junge Migranten die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust aneignen. Die Studie der Erziehungswissenschaftlerin Viola Georgi (2003), die Interviews mit 32 Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern durchgeführt hat, eröffnet uns erste Einblicke.
Georgi betont, dass bei der der überwiegenden Zahl der befragten Jugendliche weniger die national-kulturelle Herkunft ihre Umgangsweise mit der NS-Vergangenheit prägt, sondern viel mehr ihre Selbst- und Fremdpositionierungen als Angehörige einer Minderheit in der deutschen Gesellschaft, d.h. ihr Wissen über den Nationalsozialismus dient den Jugendlichen als Deutungshintergrund für ihre eigene Lebenssituation in Deutschland. Sie hat vier Typen von Geschichtsbildern junger Migranten herausgearbeitet: Der erste Typ identifiziert sich vor allem mit den Opfern des Nationalsozialismus und stellt Beziehungen zur selbst empfundenen Diskriminierung in Deutschland her. Der zweite Typ übernimmt aus Anerkennungs- und Zugehörigkeitsbedürfnissen die Perspektive der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit oft rechtfertigenden Motiven auf die Zuschauer, Mitläufer und Täter des Nationalsozialismus. Der dritte Typus identifiziert sich sehr stark mit der eigenen ethnischen oder religiösen Gemeinschaft und verknüpft deren Verfolgungsgeschichte argumentativ mit dem Holocaust. Der vierte Typus beurteilt den Holocaust aus einer postnationalen und universalistischen Perspektive, für den weder die eigene ethnische Herkunft noch die Herkunft der Opfer, Täter oder Mitläufer nationalsozialistischer Verbrechen eine Rolle spielen. Der historische Bezugspunkt ist für diesen Typ die gesamte Menschheit (vgl. ebd: 299-308).
Georgis qualitative Studie erlaubt keine Aussagen über die quantitative Verteilung der verschiedenen Typen. Bemerkenswert an ihren Ergebnissen ist, dass junge Migranten mehrere und widersprüchliche Optionen „historisch-politischer Selbstpositionierung für sich beanspruchen“ (ebd.: 309).
3.1.3. Nationalsozialismus im Unterricht.
Eine Frankfurter Forschergruppe hat den Geschichtsunterricht über das Thema Nationalsozialismus und Holocaust in zwei Klassen der gymnasialen Oberstufe erstmals empirisch untersucht (vgl. Hollstein u.a. 2002; Meseth u.a. 2004b). Der Forschergruppe ging es dabei nicht um die Qualität einzelner Unterrichtsstunden, sondern um die Frage, nach der spezifischen Leistungsfähigkeit des Unterrichts für die Behandlung eines Themas, das den besonderen Anspruch hat neben dem Lernen historischer Faktoren auch moralische Haltungen zu vermitteln.
Aus systemtheoretischer Perspektive betrachten die Autoren Unterricht als eine Form „pädagogischer Kommunikation“, in dem eine besondere Interaktionsdynamik entsteht, die durch Anwesenheitspflicht, Leistungsbewertung und Selektion sowie durch ein asymmetrisches Rollenverhältnis zwischen Lehrern und Schülern erzeugt wird. Die Autoren formulieren die Hypothese, dass Lehrer und Schüler gleichermaßen Interesse daran haben, die Form Unterricht aufrechtzuerhalten. Nur in einer der von ihnen analysierten Stunden sei die übliche Grundform unterrichtlicher Kommunikation aufgehoben worden, d.h. Lehrer und Schüler diskutierten ein offenes Problem.
Die Schüler reagierten bezogen auf das Thema Nationalsozialismus in reflexiver Weise, d.h. ihr Wissen um die hohe moralische Bedeutsamkeit des Themas schränke sie ein, sich zu den Inhalten als auch zu den Erziehungsabsichten ablehnend zu verhalten. Das reflexive Wissen über die Form Unterricht und die Besonderheit des Themas ermögliche es den Beteiligten in der Regel, „die Unterrichtskommunikation der Form nach aufrechtzuerhalten“. Widerständigkeit der Schüler, die sich als „Überdruss am Thema“ oder „provokativen Umgang mit Inhalten“ zeige, werde in „den Bereich der inoffiziellen Kommunikation“ abgedrängt „die neben und nach dem Unterricht“ ablaufe (Meseth u.a. 2004b: 138). Die thematische Reflexivität der Schüler resultiere nicht aus detailliertem Faktenwissen oder moralisch gefestigten Haltungen zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust sondern aus einer Sensibilität für die gesellschaftliche Bedeutung des Themas, das auf einem durch „mitlaufende Sozialisation“ erzeugten „impliziten Metawissen“ beruhe und nicht auf durch Unterricht und Erziehung vermittelten „expliziten Wissen“ (ebd.: 139).
Die Unterrichtsbeobachtung zeige, so die Autoren, dass die Beteiligten zwischen einer „Hauptbühne“, auf die die „gesellschaftlich zulässigen Formen der Thematisierung“ und einer Nebenbühne“, zu der „die Zwischenrufe und Metakommunikationen“ gehören, unterscheiden. Auf dieser Basis formulieren sie die Hypothese, dass der Unterricht über den Nationalsozialismus und Holocaust nur stattfinden kann, wenn „der institutionalisierte Konsens über den Gegenstand bereits vorgängig von allen Beteiligten weitestgehend beachtet“ wird. Dies bedeutet, dass eine moralische Verurteilung des Nationalsozialismus, die als zentrales Lernziel formuliert wird, für ein Gelingen des Unterrichts bei den Schülern bereits vorhanden sein muss. Die Kommunikation im Unterricht ermögliche es den Schülern,
Informationen über und Bewertungen des NS-Staates kennen zu lernen. Dies erhöhe „die Optionen für Dispositionsänderungen“. Ob aber Erziehung im eigentlichen Sinne des Wortes stattgefunden hat, d.h. ob die Schüler Bewertungen übernommen und potentiell auf ihr Verhalten anwenden, oder ob sie mit dem erworbenen Wissen „nur situativ, taktisch und opportunistisch umgehen“, könne „die pädagogische Kommunikation nicht kontrollieren“ (ebd.: 141).
Die Grenzen des moralischen erziehenden Unterrichts sind nach Meinung der Autoren eng gezogen. Sie plädieren dafür, „überhöhte Erziehungsansprüche“ zurückzunehmen. Erziehender Unterricht zum Holocaust könne kein Ersatz für Geschichtspolitik sein, sondern nur Resonanzkörper für das, was in Gesellschaft und Politik geschehe. Es wäre schon viel erreicht, „wenn Schule und Unterricht reflexiv Anschluss an das Niveau der öffentlichen intellektuellen und wissenschaftlichen Diskussion hielten und es den Schülern ermöglichten, an diesen Debatten kompetent teilzunehmen“ (ebd.: 143). Im Hinblick auf das Thema Nationalsozialismus und Holocaust besäßen Schüler und Lehrer ein erhebliches Maß an „awareness“. Dies ermögliche seitens der Erwachsenen mehr Gelassenheit gegenüber Wissensdefiziten, ironischen Kommentaren und Provokationen. Deshalb sei es weniger wichtig, bei den Einstellungen und Kompetenzen der Schüler anzusetzen als vielmehr dafür zu sorgen, dass der „Unterricht in seiner Programmatik wie in seiner Konzeption“ Schritt halte „mit den öffentlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über Nationalsozialismus und Holocaust“ (ebd.). Zu ändern seien jedoch nicht die grundlegenden Paradoxien erziehenden Unterrichts.
[...]
[1] Das Drehbuch des Films ist abgedruckt in Schrader (1992: 291-409). Das Buch von Remarque erschien im Januar 1929 und erreichte innerhalb eines Jahres eine Auflage von 910000 Exemplaren. Es wurde in fast alle europäischen Sprachen übersetzt und hatte in Frankreich, England und den USA Auflagen von 300000 (vgl. ebd.: 11).
[2] Die Dolchstoßlegende war eine politische Verschwörungstheorie der Deutschnationalen und der extremen Rechten, die schon unmittelbar nach Kriegsende propagiert wurde. Demnach war nicht die militärische Überlegenheit der Entente für die militärische Niederlage Deutschlands verantwortlich, sondern Sozialdemokraten und Kommunisten, die unter jüdischem Einfluss stehend durch Streiks und Aufstände in der Heimat den Soldaten an der Front in den Rücken gefallen, was einem "Dolchstoß" gleichkomme.
[3] Vgl. den Ausstellungskatalog von Hesse/Springer (2002).
[4] Im Deutschen Reich war „Rassenschande“ seit dem September 1935 ein Straftatbestand. Das Delikt bezog sich zunächst auf Eheschließungen und außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nicht-Juden und wurde in der Kriegszeit auf Kontakte zwischen Kriegsgefangenen bzw. Zwangsarbeiter und Deutschen ausgeweitet. Während polnische und sowjetische Kriegsgefangene exekutiert wurden, wurden die Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen gedemütigt. Sie wurden kahl geschoren und mit einem umgehängten Schild durch die jeweiligen Orte geführt (vgl. Hesse 2002: 118f.)
[5] Die Unterscheidung zwischen kulturellen und kommunikativen Gedächtnis geht auf den Ägyptologen Jan Assmann zurück. Er definiert das kulturelle Gedächtnis als „Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht“ (zitiert in Welzer u.a. 2002: 12). Dagegen ist das kommunikative Gedächtnis unmittelbar an das individuelle Gedächtnis einzelnen Personen gebunden und steht für die zeitlich und sozial begrenzten Erinnerungsformen. Das kommunikative Gedächtnis kann man auch als „Kurzzeitgedächtnis“ einer Gesellschaft bezeichnen. Es umfasst ca. 80 Jahre. Das Familiengedächtnis ist ein Teilbereich des kommunikativen Gedächtnisses (vgl. ebd.: 12f.).
Details
- Titel
- Nationalsozialismus im Unterricht der Sekundarstufe I
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V297672
- ISBN (Buch)
- 9783956843310
- ISBN (PDF)
- 9783956848315
- Dateigröße
- 4563 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Didaktik Geschichtsunterricht Historie moralische Lernziele Erster Weltkrieg Zweiter Weltkrieg Hitler
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2006, Nationalsozialismus im Unterricht der Sekundarstufe I, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297672
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.