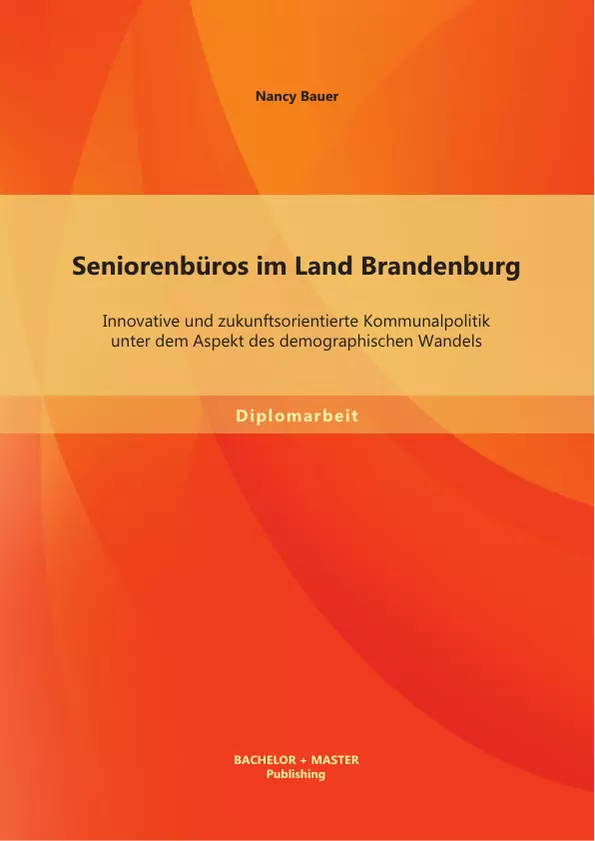Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos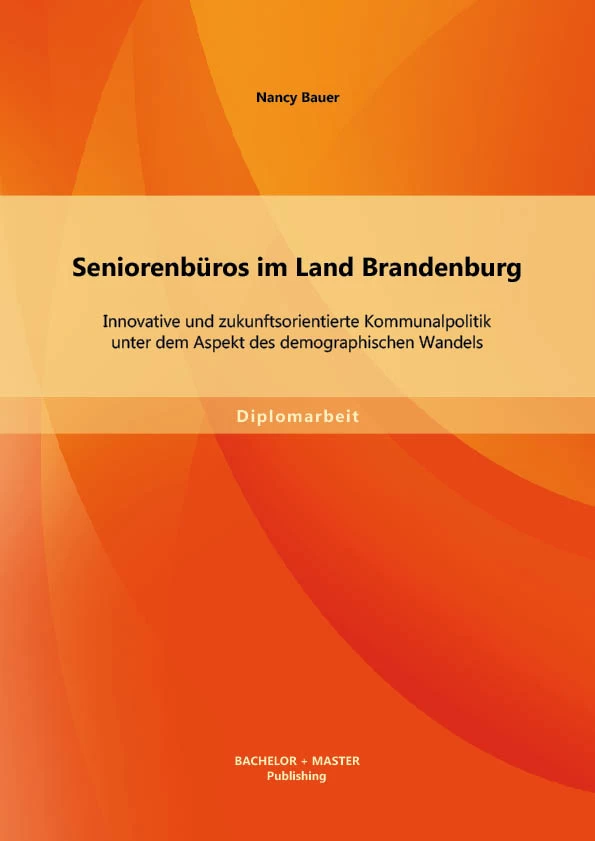
Seniorenbüros im Land Brandenburg: Innovative und zukunftsorientierte Kommunalpolitik unter dem Aspekt des demographischen Wandels
Diplomarbeit, 2011, 52 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
1.1. Aktuelle demographische Entwicklungstrends
Entsprechend den aktuellen Bevölkerungsprognosen der Landesregierung Brandenburg werden sich die Einwohnerzahlen des Landes bis zum Jahr 2020 weiterhin auf ungefähr 2.411.000 Einwohner verringern. Dabei wird diese Entwicklung von vier Trends bestimmt, die im Folgenden näher erläutert werden.
Geburtendefizit
Einer der vier Trends stellt das Geburtendefizit dar. Obwohl die Wiedervereinigung Deutschlands schon viele Jahre vergangen ist, liegt die Geburtenrate im Land Brandenburg mit 40 bis 50 Prozent unter dem Niveau, das für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig ist. Die Folgen sind bereits heute schon in vielen Kommunen sichtbar. Schließungen von Schulen oder Kindertageseinrichtungen und die Zunahme von Wohnungsleerständen sind die aktuellen Themen in den Kommunalsitzungen. Allerdings gibt es auch wachsende Städte und Gemeinden im Land Brandenburg, die ihre Bildungs- und Betreuungsangebote weiter ausbauen müssen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Allerdings werden die Kinder, die nach der Wiedervereinigung nicht geboren wurden, in der Elterngeneration fortlaufend fehlen[1].
Bevölkerungswanderungen
Als weiterer Trend stellen sich die Wanderungen der Bevölkerung dar. Das Berliner Umland erreichte 1998 mit fast 30.000 Personen den größten Zuzugsüberschuss aus Berlin. Diese Berliner Stadt-Umland-Wanderung reduzierte sich stark und sank bis 2003 auf nur noch 12.500 Personen. Von 1991 bis 2003 sind 2.035.000 Menschen aus den neuen Bundesländern in die alten Bundesländern abgewandert, dagegen zogen nur 1.190.000 Menschen in entgegengesetzter Richtung. Aus dem Land Brandenburg ziehen nahezu konstant jährlich knapp 70.000 Menschen fort, seit 1991 bis ins Jahr 2011 sind das ungefähr 1.400.000 Personen. Eine Kompensation durch Zuzüge ist bereits seit dem Jahr 1997 nicht mehr gegeben[2].
Die Alterung der Gesellschaft
Als dritten Trend stellt sich die Alterung der Gesellschaft dar. Von 1992 bis 2002 hat sich die Zahl der Brandenburger, die 65 Jahre oder älter waren, von 126.000 auf 440.000 Senioren um 40 Prozent erhöht. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung des Landes stieg in diesem Zeitraum von 12 auf 17 Prozent und bis zum Jahr 2020 wird jeder Vierte zu den Senioren zählen[3]. Im Jahr 2008 waren von den insgesamt 2.522.500 Einwohnern des Landes 22,0 Prozent der Bevölkerung Senioren ab 65 Jahre; Tendenz steigend. In Zahlen ausgedrückt, entspricht das 554.950 Senioren. Dagegen machten Kinder unter 6 Jahren den geringsten Bevölkerungsanteil mit 4,5 Prozent, also 113.512 Kindern aus (siehe Anhang A)[4].
Räumliche Entwicklungsdifferenzen
Als vierten und letzten Trend zeigt sich im Land Brandenburg die unterschiedliche Entwicklung zwischen dem engeren Verpflechtungsraum und dem äußeren Entwicklungsraum[5]. Das Bundesland besteht in seinem Zentrum aus den Randgebieten von der Bundeshauptstadt Berlin – dem sogenannten „Speckgürtel“, wozu auch die Landeshauptstadt Potsdam gehört und andererseits zeigt das Land in weiten Teilen einen ländlichen Charakter[6]. Für das Berliner Umland wird bis 2030 ein gleichbleibender Bevölkerungszuwachs angenommen, dagegen zeigen die Prognosen für den äußeren Entwicklungsraum des Landes einen weiteren Anstieg des Bevölkerungsrückgangs. Dieser Rückgang wird sich ab dem Jahr 2012 weiter verstärken, da die geburtenschwachen Jahrgänge der Wendezeit ins fortpflanzungsfähige Alter kommen, aber nicht ausreichend Kinder geboren werden. Dieses Geburtendefizit wird zusammen mit Abwanderungen, vor allem junger Menschen in den engeren Verpflechtungsraum des Landes oder nach Westdeutschland, den Rückgang der Einwohnerzahlen im äußeren Entwicklungsraum weiter prägen. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem Rückgang von ungefähr 363.500 Menschen gerechnet, davon ca. 92 Prozent natürlich bedingt. Die Bevölkerungsproportionen verschieben sich positiv für den engeren Verpflechtungsraum des Landes, so dass in dieser Region mit einem Anstieg von 39 auf 46 Prozent der Brandenburger Gesamtbevölkerung gerechnet wird, obwohl diese Region nur 15 Prozent der Gesamtfläche des Landes einnimmt[7].
1.2. Ursachen demographischer Entwicklungstrends
Die vorhergehend erläuterten Entwicklungstrends des demographischen Wandels sind auf Ursachen zurückzuführen, die im Folgenden näher und einzeln erläutert werden.
Geburtenrückgang
Der Geburtenrückgang im Land Brandenburg zeigt vielseitige Ursachen auf. Zum einen ist in den letzten drei bis vier Jahrzehnten die Familiengründung zunehmend zu einer bewussten Entscheidung für oder gegen ein Kind geworden. Diese Entscheidungen wurden von seitens der Medizin durch die Zunahme an sicheren Empfängnisverhütungsmitteln unterstützt. Auch ist festzustellen, dass sich ein gesellschaftlicher Wertewandel vollzogen hat und auch gleichsam der Rückgang der durchschnittlichen gewünschten Familiengröße beeinflusst wurde[8]. Glaubt man den Aussagen des ,Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung‘ liegt die Geburtenrate in Deutschland bei Frauen zwischen von 15 bis 45 Jahren aktuell bei 1,36 Kinder. Demnach haben 100 Frauen in dieser Altersspanne 136 Kinder. Um eine Bevölkerungsstabilität zu erreichen, wären mindestens 208 Kinder notwendig. Da das Durchschnittsalter einer Mutter bei ihrer ersten Geburt heute bei 30 Lebensjahren liegt, was nach Expertenschätzungen weiter ansteigt, wird es mit zunehmendem Alter immer schwieriger auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Folglich werden noch weniger Kinder geboren werden[9]. Untersuchungen ergaben, dass die Wertevorstellungen Brandenburger Jugendlicher zeigen, dass die Familie in der Wertehierarchie nur noch von der Hälfte der Befragten als „sehr bedeutsam“ eingestuft wird. Demnach nimmt die Familiengründung den dritten Platz in der Wertehierachie ein. Die vorrangigen Plätze machen deutlich, dass es den Jugendlichen in Brandenburg wertvoller ist, das Leben zu genießen und einen erfüllten Arbeitsplatz zu haben[10]. Bei einer Repräsentativbefragung der 18- bis 44jährigen Bevölkerung durch das Institut für Demoskopie Allensbach sollten die Befragten Gründe nennen, die gegen ein Kind sprechen. Im Ergebnis gaben 47 Prozent an, dass ein Kind für sie eine große finanzielle Belastung wäre und bei 37 Prozent der Befragten vertragen sich die beruflichen Pläne nur schwer mit einem Kind[11]. Der Anteil an Frauen mit Kindern liegt in Deutschland ungefähr bei einem Anteil von zwei Drittel aller Frauen. Bezüglich des Geburtenrückgangs sind die Frauen und Männer besonders entscheidend, die ein Leben ohne Kinder führen. Dazu zählen die Männer und Frauen, die sich bewusst für ein Leben ohne Kinder entscheiden haben und gleichsam zählen dazu diejenigen Menschen, die ungewollt z. B. aufgrund von Unfruchtbarkeit oder fehlender Zweisamkeit ein Leben ohne Kind führen müssen. Laut dem Statischen Bundesamt waren im März 2004 in Westdeutschland 30 Prozent der Frauen zwischen 37 und 40 Jahren und in Ostdeutschland 22 Prozent der gleichaltrigen Frauen ohne Kinder[12]. Dabei zeigt sich verstärkt, dass gerade Frauen mit einer guter Ausbildung und einem hohem Bildungsabschluss weniger Kinder in ihrem Leben gebären als gewünscht. Grund ist, dass diese Frauen meist erst nach langen Bildungswegen, ebenfalls wie ihre männlichen Kollegen, in die Berufswelt eintreten. Gerade in dieser Einstiegsphase liegen die Prioritäten darin, Erfahrungen im Beruf zu sammeln, sich im Unternehmen zu integrieren und einen möglichst sicheren Arbeitsplatz zu erhalten. Familiengründung rückt dabei in weite Ferner und wird oft als zusätzliche Belastung angesehen. Ein Kind zu haben, verbinden viele kinderlose Paare mit der Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes und eine schlechte Vereinbarkeit von beruflichem Stress und abverlangter Flexibilität vom Arbeitgeber, verbunden mit dem eigenen Anspruch an eine gute Kindererziehung nach Feierabend. Viele Paare sehen nach der Geburt des ersten Kindes ihre Familienplanung als abgeschlossen, da der Wunsch nach einem zweiten Kind oft durch die wirtschaftliche Situation oder durch den Mangel an Betreuungsmöglichkeiten – wenn Freunde oder Großeltern selbst erwerbstätig sind oder weit entfernt wohnen – ein unerfüllter Wunsch bleiben muss[13].
Bevölkerungswanderung
Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach ergab, dass die Mehrheit der Befragten eine feste Partnerschaft, eine abgeschlossene Berufsausbildung beider Partner und die berufliche Absicherung mit einem guten Einkommen sowie gute wirtschaftliche Verhältnisse als die wichtigsten Faktoren ansehen, um in ihrem Leben Platz für ein Kind zu haben[14]. Gerade diese vier Faktoren führen zu Wanderungen der Bevölkerung, wie bereits unter Punkt 1.1. erwähnt. Gerade das Land Brandenburg ist durch steigende Motivation zum Abwandern von vor allem gut ausgebildeten jungen Menschen besonders betroffen. Nicht alle Auszubildende, vor allem die Frauen, können nach der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Sie alle, Frauen wie Männer, sind auf der Suche nach besseren Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten mit mehr Sicherheit, besserer Bezahlung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten, um mit all diesen Bemühungen ihre Lebensbedingungen verbessern zu können[15].
Steigende Lebenserwartungen
Wer bleibt, sind die älteren Menschen. Sie stellen mit ihrer ständig steigenden Lebenserwartung einen Teilprozess der demographischen Veränderung dar[16]. In Deutschland wurden 1871 die Jungen im Schnitt 39 Jahre und die Frauen 42 Jahre alt. Heute haben die in Deutschland 2004 geborenen Jungen entsprechend dem Statischen Bundesamt eine Lebenserwartung von 84,9 Jahren und die Mädchen können sogar statistisch gesehen 90,4 Jahre alt werden[17]. Schätzungsweise werden die heute 30-Jährigen ein Alter von 90 Jahren und mehr erreichen und für viele der heute geborenen Kinder stehen die Möglichkeiten sehr gut 100 Lebensjahre zu erreichen[18]. Schätzungen gehen davon aus, dass bereits im Jahr 2030 bereits jeder dritte Brandenburger über 65 Jahre alt sein wird. Auch die Hochbetagten in Brandenburg, 80 Jahre und älter, werden um ungefähr 105.000 Personen zunehmen und sich gegenüber dem Jahr 2004 mehr als verdoppeln[19]. Ursachen für den Anstieg der Lebenserwartungen sind vor allem im medizinischen Fortschritt, in der verbesserten Ernährung, in der verbesserten Hygiene und den verbesserten Lebensbedingungen zu finden[20].
1.3. Folgen und Lösungsansätze für die Kommunen
Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sich manche kommunale Gebiets-körperschaften schon seit einigen Jahren sehr intensiv mit dem Thema des demographischen Wandels auseinandersetzen, wobei andere wiederum das Thema noch gar nicht entdeckt haben. Um den Stellenwert dieses Themas in den Kommunen zu erfahren, ließ die Bertelsmann Stiftung im Februar 2005 bundesweit 1.436 Bürgermeister befragen. Zielgruppe dieser Befragung waren nur Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern. Dabei wurden die Kommunen befragt, wie sie die Gestaltung des demographischen Wandels wahrnehmen und welchen Handlungsfeldern sie eine besondere Bedeutung beimessen. Insgesamt antworteten 648 Kommunen auf die Befragung, was einem Rücklauf von 45,13 Prozent der Befragten entspricht. Im Ergebnis empfanden 72,1 Prozent das Thema als „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Gleichzeitig nahm dieses Thema in den neuen Bundesländern einen deutlich höheren Stellenwert ein, als in den alten Bundesländern. Insgesamt 32,1 Prozent der befragten Bürgermeister bewerteten ihre Fähigkeit, den Auswirkungen des demographischen Wandels gewachsen zu sein, mit ausreichend oder vollkommen ausreichend. Dazu schätzten 65 Prozent der Bürgermeister ihre Möglichkeiten und Fähigkeit zu wirklichen Veränderungen als gering ein[21]. Im Ergebnis dieser Befragung wird deutlich, dass noch nicht alle Kommunen dem demographischen Wandel mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit begegnen. Doch wird dieser Schritt unumgänglich sein, um in den Kommunen die Verantwortlichen zum Handeln zu bewegen und die notwendigen Veränderungen oder Anpassungsmaßnahmen zu erkennen und die entsprechenden Handlungsstrategien einzuleiten. Bei diesen Bemühungen auf kommunaler Ebene sind die Bürger und Einwohner mit ihren Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen zu beteiligen, zu integrieren und sie müssen diese Aufgaben als Gemeinschaftsaufgabe erkennen und auch gemeinschaftlich an deren Umsetzung arbeiten. Um das zu erreichen, muss daher die Kernaufgabe der Zukunft sein, dass die Politik die Menschen verstärkt für dieses Thema sensibilisiert und sie mit mehr Transparenz informiert und auf die kommenden Veränderungen vorbereitet[22]. Als sehr gute Ansätze stellte beispielsweise die Stadt Bielefeld als erste eine Demographiebeauftragte ein und der Rat der Stadt Schwerte bildete als erste Stadt in Nordrhein-Westphalen einen Demographie-Ausschuss[23].
Die demographische Entwicklung in den Bevölkerungsstrukturen wird zu einer Vielzahl von Veränderungen in den Bereichen unseres Lebens, wie z. B. Kommunikation, Wohnen, Arbeiten und Reisen führen[24]. Durch die Abwanderungen der Bevölkerung im Land Brandenburg wird in den nächsten Jahren ein verstärkter Fachkräftemangel eintreten, der auch durch MitarbeiterInnen aus anderen EU-Ländern nicht hinreichend gedeckt werden kann. Die jahrelangen Erfahrungen und das Wissen von älteren Menschen werden in den Firmen länger genutzt werden müssen, um die Defizite an Fachkräfte ausgleichen zu können[25].
Dadurch wird zukünftig der Stellenwert älterer Menschen in unserer Gesellschaft neu definiert werden, d. h. sie werden nicht nur Würdigung ihrer bisherigen Lebens-leistungen erfahren, sondern auch durch ihr aktuelles Engagement verstärkt positive Würdigung erhalten. Gleichzeitig muss das Land Brandenburg aktiv werden, um weitere Abwanderungen von jüngeren Menschen zu vermeiden. Dazu müsste man den jungen Menschen eine sichere und berufliche Perspektive auf einen ansprechenden und zukunftsfähigen Arbeitsplatz bieten. Hier liegen derzeit die Schwerpunkte für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik im Land, denn man hat erkannt, dass auch diese Faktoren wichtig sind, um die Zuwanderung ins Land zu fördern und zu festigen. Derzeit gibt es sogar Überlegungen, dass man die abgewanderten BrandenburgerInnen trotzdem mit regelmäßigen Informationen zum Arbeitsmarkt des Lands informiert, um einen Rückzug zu erreichen. Erfahrungen zeigen, dass gerade der Besitz von Eigentum und soziale Bindungen beispielsweise durch Familie oder Freunde die Abwanderungen stoppen oder einen Rückzug begünstigen können. Zusätzlich werden sich auch die Nutzungsansprüche verändern, da die älteren Menschen anderer Dienstleistungen nachfragen, wie junge Menschen[26]. Es wird zu einer verstärkten Bündelung von Versorgung, Dienstleistung und Infrastruktur kommen. Gleichzeitig muss die Verwaltung ihrer Daseinsvorsorge gerecht werden können. Hier muss die öffentliche Verwaltung lernen, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren und durch Aufgabenbündelung in Form von „alles aus einer Hand“ ihre Stärken herauszuarbeiten[27]. Zum Beispiel wird gerade im ländlichen Raum zunehmend der Mangel an Ärzten und Fachärzten beklagt. Auch der Brandschutz in den Kommunen ist aktuelles Thema. Wenn aus den Kommunen die jungen Menschen abwandern, wird es in Zukunft schwer werden in kleinen Kommunen ausreichend FeuerwehrmitarbeiterInnen für die Einsätze bei der freiwilligen Dorf- oder Gemeindefeuerwehren finden zu können.
Doch auch die Dezentralisierung ist bei der Leistungserfüllung in der öffentlichen Verwaltung ein zukunftsträchtiges Thema. Der Kontakt mit dem Bürger bei der Erbringung der Leistung oder bei der Erstellung des Produktes muss dezentral erfolgen, wobei hingegen die eigentliche Bearbeitung in dem Fachbereich erfolgen kann, der über das entsprechendes Personal und notwendige Technik verfügt. Mit diesen Prinzipien folgt die Verwaltung bekannten Mustern aus der privaten Wirtschaft, indem eine Differenzierung von dem Front- und dem Backoffice vorgenommen werden. Zukünftig wird die Verwaltung ihre bürgernahe Versorgung auch über ein größeres Flächennetz ausbauen, z. B. bieten einige Verwaltungen mittlerweile ihre Leistungen mobil (z.B. mobiler Bürgerservice) oder über das Internet (Bsp. Elster-Formular für den Lohnsteuerjahresausgleich) an. Auch die Betreuung wurde durch Tagesmütter oder auch durch häusliche Pflege und ambulante Versorgung dezentralisiert. Weitere Beispiele dafür sind Bildung in Form von eLearning oder die Gesundheitsversorgung in Form von mobilen Sprechstunden. Auch im öffentlichen Personennahverkehr gibt es Beispiele wie der Rufbus oder Anschlusstaxis zu nennen[28].
2. Verwaltung als Dienstleister – Wenn der Bürger zum Kunden wird
Der Begriff des New Public Management (NPM) wird seit etwa Mitte der neunziger Jahre in Deutschland verwendet und ist der Obergriff für die globalen Verwaltungsreformbewegungen, die auf eine institutionelle Sichtweise basieren. Die Schwerpunkte des NPM sind die Modernisierung der öffentlichen Einrichtungen und die Schaffung und Einführung neuer Formen öffentlicher Verwaltungsführung[29].
Abgesehen von Veränderungsstrategien im Bereich der Organisationsstrukturen, Verfahren und Personal erscheinen aus Sicht des NPM ergänzende Schritte zur Steigerung der Produktivität und Kundenorientierung notwendig. Dabei wird im Wesentlichen auf zwei konzeptionelle Ansätze zurückgegriffen. Das Total Quality Management (TQM) und das Management by Competition (MbC). Beim Total Quality Management geht es um das systematische Erreichen des höchstmöglichen Qualitätsstands der Produkte und Leistungen eines Betriebes, also die qualitätsmaximale Outputorientierung. Dies soll durch die prinzipielle Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen und durch die ständige Verbesserung von Produkten-, Service- und Informationsqualitäten sowie durch die Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht werden. Durch das Management by Competition soll die herkömmliche Bürokratie aufgelöst werden und marktwirtschaftliche Mechanismen gefördert werden. Erhofft wird sich dabei eine Produktionssteigerung und eine Kundenorientierung durch Schaffung interner und externer Wettbewerbsstrukturen und die Einführung von Leistungsvergleichen[30].
Gleichsam steht der Begriff des Neuen Steuerungsmodells (NSM) ebenfalls für die Modernisierung der Verwaltung und dem Ziel der marktwirtschaftlichen und kundenorientierten Dienstleistung durch die Verwaltung. Dazu wurden Konzepte von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) erstellt, welche inhaltlich starke Parallelen zum NPM aufweisen. Daher wird das NSM in der Literatur auch gerne als die deutsche Variante des NPM gesehen.[31] Beide verfolgen das Ziel der Kundenorientierung, um den Adressaten von Verwaltungsleistungen im althergebrachten Ober- und Unterordnungsverhältnis als Untertan des Obrigkeitsstaates in einen Kunden umzuwandeln. Die Verwaltungen sollen dazu Dienstleistungskommunen werden und sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren[32].
2.1. Kundenorientierung – Versuch einer Definition
Wer den Begriff der Kundenorientierung in Bezug auf die öffentliche Verwaltung definieren möchte, wird schnell feststellen müssen, dass es in der Literatur an der Konkretisierung dessen fehlt, was darunter genau zu verstehen ist. Die Kundenorientierung wird zunächst als die neue Rolle dargestellt, die im Verwaltungshandeln Einzug nehmen soll. An die Rolle werden folglich positive Erwartungen gerichtet, in Form von: „Der Kunde ist König“. Doch bei genauer Betrachtung des Kundenbegriffs, werden auch andere Assoziationen geweckt. Denn ein Kunde richtet sein Handeln vorrangig auf seinen Konsum und seiner Bedürfnisbefriedigung aus, was folglich der Grundhaltung entspricht, in der er als Kunde der Verwaltung gegenübertritt. Da die Verwaltung in ihrer Arbeit aber nicht ausschließlich Dienstleistungen in klassischen Sinne (Beispiel: Platz in einer Kindertageseinrichtung, Standesamtliche Trauung) erbringt, sondern oftmals auch aufgezwungene Leistungen (Beispiel: Baugenehmigungen oder Kfz-Kennzeichen) für den Kunden vollführt, ist es schwer diese Leistung als „Dienst“ zu verstehen. Dazu kann das Ausstellen von einem Verwarngeld für falsches Parken oder die Erteilung eines Bußgeldes nicht einmal mehr als „Leistung“ angesehen werden. Hier wird schon deutlich, dass der Bürger nicht immer Kunde sein kann[33]. Leider wird mit dem Begriff „Kundenorientierung“ allzu oft der verwandte Begriff der Bürgernähe synonym verwendet, so dass oft Assoziationen zum Begriff der Bürgerbeteiligung geweckt werden. Allerdings sind die Begriffe der Kundenorientierung und Bürgernähe stark inhaltlich vom dem Begriff der Bürgerbeteiligung abzugrenzen. Kundenorientierung, Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit drückt in der Regel eine Aufwertung der Rolle des Bürgers aus, der nicht mehr Untertan des Staates, sondern Kunde sein soll. Das Konzept der Bürgerbeteiligung geht noch einen Schritt weiter und bezieht ihre Bürger in die Dienstleistungen mit ein. Der Bürger ist nicht passiver Konsument, sondern ist aktiv im Produktionsprozess der öffentlichen Dienstleistungen eingebunden. Das Rückgrat der Bürgerbeteiligung ist die Selbstbeteiligung der Kunden und parallel die Idee einer stückweisen Ausgliederung der Produktion öffentlicher Leistungen auf die Bürger, vergleichbar mit der automatisierten Selbstbedienung in den Supermärkten, mit dem Ziel durch Rationalisierungsmaßnahmen eine „schlanke Verwaltung“ zu erschaffen.[34]
2.2. Die Rollen der öffentlichen Verwaltung
Die Zufriedenheit der Kunden ist abhängig von der Leistung der öffentlichen Verwaltung. Dabei nimmt sie in ihrer Arbeit immer wieder unterschiedliche Rollen ein, die in der Abb. 1 dargestellt werden.
Die Verwaltung muss zur Steigerung und Optimierung ihrer Leistungen immer alle fünf Rollen in ihrer Prozessplanung mit einbeziehen, denn nur mit einer umfassenden Betrachtungsweise kann sie ihre Arbeit den Anforderungen entsprechend anpassen.[35]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: i. A. a. Quelle: Hiemstra, Jaring: Leistungsstarke Kommunen - Mehr Bürgernähe durch effektive Organisationsentwicklung, 1. Auflage, Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2008, S. 22 -[13]
2.3. Grenzen der Kundenorientierung im öffentlichen Sektor
Die Übernahme des Begriffs der Kundenorientierung im öffentlichen Sektor bleibt schwierig, da sich ein Kunde in der Privatwirtschaft durch Kaufkraft auszeichnet und für alle erhaltenen Leistungen entsprechend bezahlen muss. Wenn die öffentliche Verwaltung alle ihre Kosten auf ihre Leistungen und schließlich auf die einzelnen Produkte herunter rechnen würde, um sie ihrem Kunden kostendeckend in Rechnung zu stellen, würden einige Leistungen folglich für die Bürger unbezahlbare „Preise“ erlangen. Zugleich könnten die Motive des öffentlichen Handelns, die Grundsätze des Sozialstaates, das Rechtsstaatsprinzip und das Allgemeinwohl verletzt sein. Hier zeigt sich, dass die öffentliche Verwaltung Aufgaben wahrnimmt, die in der privaten Wirtschaft nie kostendeckend und gewinnbringend erfüllt würden könnten, somit privatwirtschaftlich auch nie zu einem Angebot werden können. Des Weiteren ist es eher unangebracht im Bereich der Hoheitsverwaltung von einem Kunden zu sprechen, da es dabei um demokratisch erlaubte Eingriffe des Staates in die Rechte der Freiheit und des Eigentums der Bürger geht und die Bezeichnung als Kunde hier eher beschönigend und in der Situation unangepasst wirkt.[36] Zusammenhängend lässt sich feststellen, dass die Rolle des Bürgers bzw. der Bürger auf der Ebene des Dienstleister im öffentlichen Sektor durch die Rolle als Kunde bzw. Kundin ergänzt, aber nicht ersetzt wird. Gleichzeitig soll der Dienstleistungsgedanke unterstützt werden, wobei nicht vergessen werden darf, dass die Privatwirtschaft auch den Kunden nicht jeden Wunsch erfüllt. Hilfreich ist eine Abgrenzung von Auftraggeber (BürgerInnen) und den Leistungsabnehmern (KundenInnen), denn die Verwaltung ist dem Auftraggeber verpflichtet, und wird von diesem dazu angetrieben, für ihre KundenInnen eine bestmögliche Dienstleitung zu erbringen.[37]
2.4. Bürgerbüros im Trend der Kommunalverwaltung
Ende der siebziger Jahre wurde in der Stadt Unna die Idee eines Bürgeramtes geboren, doch trotz großem Interesse der Öffentlichkeit gab es bis in die 80er-Jahre hinein nur wenige Nachfolger dieses Modells[38]. Erst zu Beginn der 90er Jahre findet mit dem Modellprogramm „Bürgerladen Hagen“ die Idee der kundenorientierten Angebotsstrukturen neue Aufmerksamkeit[39]. Bevor aber genau auf die Bürgerbüros und deren Aufgaben eingegangen werden kann, muss die Bemerkung vorangestellt werden, dass es weder in der Literatur und noch in den deutschen Kommunen eine einheitliche Bezeichnung für die Bürgerbüros gibt. Ob sie nun Bürgerbüro, Bürgeramt, Bürgerzentrum, Bürgerservice, Bürgercenter oder Bürgerladen genannt werden, soll aus Gründen der Einheitlichkeit im weiteren Text der Begriff des Bürgerbüros verwendet werden[40].
Die angebotenen Leistungen orientieren sich in erster Linie an den Aufgaben, die vorher durch das Einwohner(melde)amt wahrgenommen wurden.[41] Dazu kommen in der Regel weitere Leistungen aus verschiedenen Fachbereichen und z. T. städtischen Eigenbetrieben, AGs und GmbHs dazu. Möglich sind in einigen Bürgerbüros auch die Vergabe von Gesprächsterminen mit dem Bürgermeister oder den Sachbearbeitern aus den Fachbereichen sowie Buchungen von Stadtführungen, Hotels oder Restaurants.[42] Im Modellprogramm „Bürgerladen“ Hagen konnten bereits am Anfang schon 30 verschiedene Dienstleistungen für die BürgerInnen/ KundenInnen angeboten werden. (siehe Anhang B)[43].
Erfahrungen haben gezeigt, dass der Trend zu kommunalen Dienstleistungen „alles aus einer Hand“ eine rasende Geschwindigkeit erreicht hat und mittlerweile in fast allen Großstädten ein Bürgerbüro vorhanden ist.[44] Dabei hat sich generell durchgesetzt, dass im Bürgerbüro solche Aufgaben wahrgenommen werden, die nur eine kurze Bearbeitungszeit von 5 bis 10 Minuten, je nach Bürgerbüro auch 15 Minuten, verlangen (front-office). Generell wird in der Literatur als Vorbild gerne die fließende und reibungslose Schaltertätigkeit aus der privaten Wirtschaft herangezogen, wie beispielsweise aus Banken oder Sparkassen bekannt ist. Die abschließende Sachbearbeitung soll allerdings nicht im Bürgerbüro, sondern im Hintergrund (back-office), also in den zuständigen Fachbereichen oder Fachämtern erledigt werden. Frau Gertrud Kühnlein steht dieser Arbeitsorganisation eher kritisch gegenüber und hegt entsprechende Bedenken. Sie sieht dadurch in vielen, nicht in allen Verwaltungen, einen Trend wachsen, der von der Beratungstätigkeit am Schalter wegführt und dabei den Weg in Richtung Automatisierung und Standardisierung von Leistungen ebnet.[45]
Bezüglich des demographischen Wandels stellt sich zwangsläufig die Frage, ob und wie diese Bürgerbüros in Zukunft von der älteren Generation angenommen werden können. Wenn in den Bürgerbüros eine umfassende Beratungstätigkeit nicht vorgesehen ist und Leistungen automatisiert und standardisiert werden sollen, wird das Folgen im Bereich der Kundenzufriedenheit älterer Generationen nach sich führen. Mit zunehmendem Alter fällt es den Menschen schwerer, neue Informationen in kurzer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten. Durch die Zunahme an elektronischen Geräten, die unser Leben vereinfachen sollen, wird andererseits einem Teil der Menschen das Leben erschwert. Beispielhaft sei hier der neue elektronische Personalausweis zu nennen, der seit November 2010 bundesweit erhältlich ist. Dieser hält viele nützliche Funktionen bereit, wie z.B. die Legitimation im Internetverkehr, welche allerdings von der älteren Generation eher selten genutzt werden wird. Die älteren Generationen verfügen in ihren Haushalten oft - nicht alle - weder über einen Personalcomputer, noch über einen Internetanschluss. Sie haben Angst vor Veränderungen und sind bereits heute teilweise durch unsere schnelllebige Gesellschaft und den technischen Fortschritten überfordert und verängstigt. Genau diese Menschen benötigen eine umfassende Beratung, die viel Zeit in Anspruch nimmt und auch den VerwaltungsmitarbeiterInnen eine hohe Sozial-kompetenz und Einfühlungsvermögen abfordert. Auch auf Behinderungen, wie z. B. Schwerhörigkeit muss seitens der VerwaltungsmitarbeiterInnen reagiert werden. Hier muss laut und deutlich mit leicht verständlichen Formulierungen die Beratung erfolgen. Ob die Verwaltungen in den kommenden Jahren diesen Ansprüchen an die Ver-waltungsleistungen in Bezug auf den demographischen Wandel gerecht werden können, wird sich zeigen müssen. Viele gute Ansätze und Zeichen eines Umdenkens in den öffentlichen Verwaltungen sind bereits heute erkennbar. Diese Ansätze in der kommunalen Verwaltung weiter auszubauen und umzusetzen, wird Aufgabe der nächsten Jahre werden.
Die Einführung von kundenorientierten Angebotsstrukturen in Verwaltungen führen nachweislich zu einem umfassenden Dienstleistungsangebot, verbessern die räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Verwaltung, verstärken die offene Sichtweise auf die Verwaltungsvorgänge und schaffen eine bessere Verbindung zwischen dem Bürger und der Verwaltung und bauen so althergebrachte Zugangsbarrieren ab. Um diese Ziele zu erreichen, werden in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden die Aufgaben gebündelt, Öffnungszeiten vorwiegend kundenorientiert in den Abendstunden verlängert, Warte- und Wegezeiten verkürzt und Raumkonzepte den Kundenbedürfnissen angepasst. Bogumil, Holtkamp und Kißler sehen diese Veränderungen eher mit kritischen Augen, da die Verwaltungen mit ihren “Bürgerbüro-Konzepten“ vor allem ihre Servicequalität verbessern möchten, aber eine Steigerung der Dienstleistungsqualität an sich nicht im Vordergrund ihrer Bemühungen steht. Denn nur alleine die Schaffung von Bürgeramtsstrukturen in der öffentlichen Verwaltung ist nicht der Weg in Richtung Kundenorientierung[46].
Bei genauerer Betrachtung der Anforderungen an die Beschäftigten in den Bürgerbüros wird deutlich, dass durch die Veränderungen der Arbeitsprozesse (workflow), die Veränderungen der Arbeitsaufgabe an sich und durch die neuen Arbeitszeiten im Bürgerbüro die Arbeit im Vergleich zu einem Einwohnern(melde)amt zwar anspruchsvoller, interessanter und abwechslungsreicher geworden ist, aber auch die Belastungen für die MitarbeiterInnen stark zugenommen haben. Gerade durch das gerne angeführte Prinzip der Allzuständigkeit (Allroundsachbearbeitung - „jeder kann alles“) müssen die Beschäftigten über bisherige Grenzen ihrer fachlichen und sachlichen Zuständigkeiten hinaus handeln. Auch müssen die MitarbeiterInnen über ein hohes Maß an Sozialkompetenz verfügen, da diese Bürgerbüros gerne als „Präsentierteller“ oder auch „Schaufenster der Verwaltung“ wahrgenommen werden. Zusätzlich sorgen die verlängerten Öffnungszeiten in den Abendstunden hinein und auch samstags für unregelmäßige Arbeitszeiten der Beschäftigten. Deshalb sieht es Gertrud Kühnlein als zentrale Voraussetzung für das Erreichen eines kundenorientierten Bürgerbüros, bei der Personalbeschaffung auf besonders engagierte und interessierte MitarbeiterInnen mit einem hohen Maß an Sozialkompetenz zu setzen.[47] In Bezug auf die Verwaltungsmodernisierung im öffentlichen Sektor sind auch in anderen Ländern ähnliche Modelle vom Bürgerbüro zu finden. In Norwegen beispielsweise bieten öffentliche Dienstleistungszentren nach dem One-Stop-Prinzip ihre Leistungen an[48]. Unter diesem Prinzip wird ein Dienstleistungskonzept verstanden, dass durch Bündelung der Kompetenzen und durch einheitliche Ansprechpartner allumfassende Dienstleistungen anbieten möchte[49]. Beachtlich ist dabei, dass es in den skandinavischen Staaten einen anderen Staatsaufbau als in Deutschland gibt und daher ein sehr großer Anteil der öffentlichen Aufgaben generell in den Zuständigkeitsbereichen der kommunalen Ebene liegen, was das Einführen von One-Stop-Shops enorm erleichtert hat[50].
[...]
[1] Vgl. [23] S. 4.
[2] Vgl. ebd. S. 5.
[3] Vgl. [23] S. 5.
[4] Vgl. [2] S. 11 und 30.
[5] Vgl. [22] S. 17.
[6] Vgl. [20] S. 84.
[7] Vgl. [22] S. 17.
[8] Vgl. [23] S. 7.
[9] Vgl. [19] S. 39.
[10] Vgl. [23] S. 7.
[11] Vgl. [17] S. 27.
[12] Vgl. [19] S. 42 und 44.
[13] Vgl. [23] S. 7f.
[14] Vgl. [17] S. 23.
[15] Vgl. [23] S. 9.
[16] Vgl. [23] S. 9.
[17] Vgl. [19] S. 51.
[18] Vgl. [23] S. 9.
[19] Vgl. [24] S. 14.
[20] Vgl. [19] S.52.
[21] Vgl. [19] S. 101f.
[22] Vgl. ebd. S. 109f.
[23] Vgl. ebd. S. 108.
[24] Vgl. ebd. S. 115.
[25] Vgl. [23] S. 19.
[26] Vgl. [23] S. 14f.
[27] Vgl. ebd. S. 15.
[28] Vgl. [23] S. 15f.
[29] Vgl. [26] S. 5f.
[30] Vgl. [6] S. 203.
[31] Vgl. [11] S. 174f.
[32] Vgl. [7] S. 7f.
[33] Vgl. ebd. S. 8ff.
[34] Vgl. [18] S. 113 und 140f.
[35] Vgl. [13] S. 21f.
[36] Vgl. [7] S. 16 und 29f.
[37] Vgl. [26] S. 55 ff.
[38] Vgl. [6] S. 209.
[39] Vgl. [18] S. 160 und 173 ff.
[40] Vgl. [21] S. 128.
[41] Vgl. ebd. S. 133 bis 135.
[42] Vgl. [18] S. 65f. und siehe [21] S. 133f.
[43] Vgl. [18] S. 53.
[44] Vgl. [21] S. 128f.
[45] Vgl. [21] S. 134f.
[46] Vgl. [5] S. 55f.
[47] Vgl. [21] S. 136f.
[48] Vgl. [12] S. 79f.
[49] Vgl. [16] URL: http://www.one-stop-services.de/
[50] Vgl. [12] S. 79f.
Details
- Titel
- Seniorenbüros im Land Brandenburg: Innovative und zukunftsorientierte Kommunalpolitik unter dem Aspekt des demographischen Wandels
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V297518
- ISBN (Buch)
- 9783956841439
- ISBN (PDF)
- 9783956846434
- Dateigröße
- 974 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- demographischer Entwicklungstrend Bürgerbüro Kundenorientierung seniorengerechte Kommunalpolitik öffentlicher Sektor
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2011, Seniorenbüros im Land Brandenburg: Innovative und zukunftsorientierte Kommunalpolitik unter dem Aspekt des demographischen Wandels, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297518
- Angelegt am
- 29.4.2015
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.