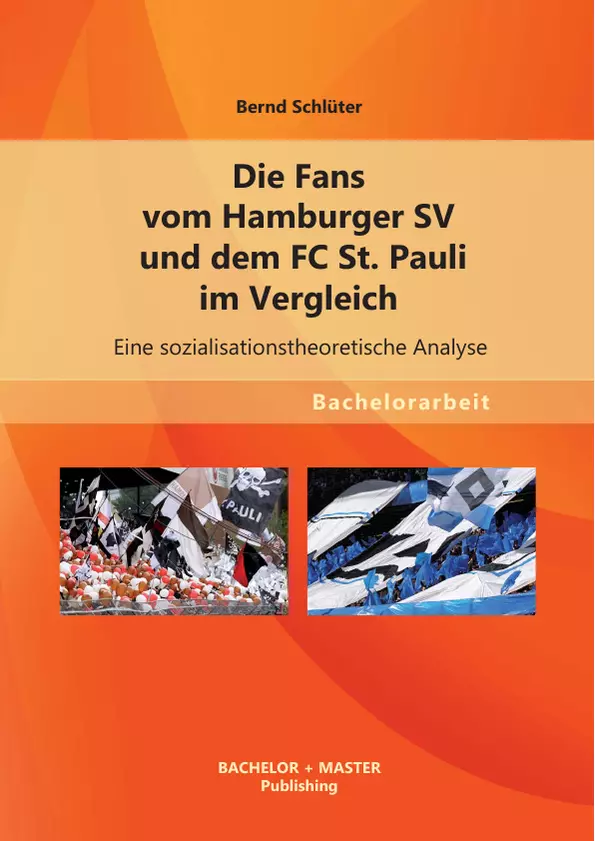Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos
Die Fans vom Hamburger SV und dem FC St. Pauli im Vergleich: Eine sozialisationstheoretische Analyse
Bachelorarbeit, 2012, 66 Seiten
Autor

Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Note
1
Leseprobe
2.2.1 Konzepte zur Kategorisierung von Fans
Bewertungen der Qualität und Intensivität von Fantum haben inzwischen so sehr in unsere Alltagssprache Einzug gefunden, dass manch Autor sich darüber schon ärgert. So schreibt Arnd Zeigler[1] im Magazin 11Freunde: „Früher war das anders. Da war man einfach Fan, und gut war’s. Heute ist das komplizierter, in regelmäßigen Abständen muss detailliert aufgeschlüsselt werden, ob man ,Erfolgsfan‘, ,Echter Fan‘, ,Sesselfan‘, ,Kuttenfan‘, ,Ultra‘, ,Kommerzfan‘ oder ob man gar das Allerschlimmste ist, nämlich ,bestenfalls Sympathisant‘“ (Zeigler 21.03.2007).
Will man aber eine sozialwissenschaftliche Analyse der Fanszene durchführen, sind solche Klassifizierungen durchaus hilfreich, weil sie letztlich das Forschungsobjekt klarer definieren und genauere Vergleiche ermöglichen. So legen auch Roose, Schäfer und Schmidt-Lux Wert darauf, dass es sinnvoll ist, „Fans abzugrenzen von gelegentlichen Zuschauern, die beispielsweise eifrig applaudieren, aber diese emotionale Beziehung nach dem Verlassen des Konzertsaals bereits beendet haben“ (Roose/Schäfer/Schmidt-Lux 2010: 13). Und das kann auch für den Vergleich von HSV und FC St. Pauli sehr wichtig sein, weil St. Pauli der Ruf vorauseilt, in Deutschland „Jedermanns Zweitverein“ zu sein (Keller 25.09.2007).
Bereits 1988 veröffentlichen die Sozialisationsforscher Wilhelm Heitmeyer und Jörg-Ingo Peter ein Modell zur Kategorisierung von Fans. Die Autoren unterscheiden zwischen fußballzentrierten, konsumorientierten und erlebnisorientierten Fans (Heitmeyer/Peter 1988: 33). Fußballzentrierte Fans sind treue Dauergäste im Stadion, die ihr persönliches Schicksal mit dem des Vereins verknüpfen (ebd.: 59f.). Konsumorientierte Fans sind in ihrer Bindung zum Verein weniger emotional und beschränken ihre Stadionbesuche auf die Saisonhöhepunkte (ebd.: 58).[2] Und erlebnisorientierte Fans wie zum Beispiel Hooligans nutzen den Fußball vor allem als Bühne zur Selbstinszenierung (ebd.: 61). Für eine aktuelle Analyse erscheint dieses (eindimensionale) Modell allerdings nicht tiefgreifend genug. Zum Beispiel kann die sich ab Mitte der 1990er entwickelnde Ultrà-Szene nicht einsortiert werden, da ihre Mitglieder sowohl fußballzentriert als auch erlebnisorientiert handeln (Schwier 2005: 22). Es gibt aber auch immer noch Autoren, die sich auf die von Heitmeyer und Peter begründete Klassifizierung beziehen (Pilz 2005: 50).
Einen anderen Vorschlag machen 1989 Michael Benke und Richard Utz, indem sie die Fans in „Novizen“, „Kuttenträger“, „Hooligans“ und „Veteranen“ unterteilen (Benke/Utz 1989: 87). Dabei erfolgt die Typisierung anhand von Zugehörigkeitsdauer zur Fangemeinschaft, Stellung in der Gruppenhierarchie und Grad der Gewaltbereitschaft (ebd.: 88ff.). Als „Novizen“ werden jugendliche Neulinge bezeichnet (ebd.: 88). „Kuttenträger“ sind gewaltbereite Fans, die sich sehr stark mit dem Verein identifizieren und sich durch Kleidung auch als dessen Anhänger zu erkennen geben (ebd.: 90ff.). Für „Hooligans“ stehen hingegen körperliche Ausschreitungen im Mittelpunkt, während die Identifikation mit dem Verein eher zweitrangig ist (ebd.: 92ff.). Und „Veteranen“ sind Krawall-Aussteiger ab 25 Jahren, die nur noch selten handgreiflich werden (ebd.: 96). Später tauchen diesbezüglich weitere Bezeichnungen auf: Ultràs und Hooltras (Pilz 2005: 50). Allerdings handelt es sich hierbei vor allem um eine Kategorisierung der Zuschauer, die ausschließlich auf den Stehplätzen anzutreffen sind. Andere Stadiongäste wie Besucher der VIP-Logen, konsumorientierte Gelegenheitsbesucher oder sogenannte Modefans werden nicht erfasst.
Einen viel beachteten Versuch der Klassifizierung hat der schottische Soziologe Richard Giulianotti unternommen, der 2002 sein Konzept der vier Idealtypen von Fußball-Zuschauern veröffentlichte.[3] Als Hauptkriterium bezeichnet er „the particular kind of identification that spectators have toward specific clubs“ (ebd.: 30). Giulianotti definiert ein zweidimensionales Modell, auf dem jeder Stadionbesucher auf der x-Achse (traditional – consumer) und der y-Achse (hot – cool) einsortiert werden kann. Als „traditionell“ bezeichnet der Autor eine eher langfristige, lokale und popkulturelle Identifikation; „consumer“ agieren hingegen eher marktorientiert und äußern dies zum Beispiel durch den Konsum von Club-Produkten. Die Hot-Cool-Variable auf der vertikalen Achse bringt zum Ausdruck, wie sehr sich die Fanbindung auf den Alltag auswirkt und wie solidarisch ein Zuschauer mit seinem Verein in Phasen des Misserfolgs ist. Hot steht für hohe Intensivität, cool für das Gegenteil. Grafisch dargestellt, ergeben sich so vier Quadranten, welche den Zuschauer entweder als „Supporter“ (traditional/hot), „Follower“ (traditional/ cool), „Fan“ (consumer/hot) oder „Flâneur“ (consumer/cool) definieren (ebd.: 31.).
Eine aktuell diskutierte Klassifikation hat Joanne Mackellar 2009 am Beispiel von Elvis-Fans veröffentlicht, die sich problemlos auf Fußball übertragen lässt. Die Autorin wendet ähnliche Kriterien an wie Giulianotti: Unter Bezugnahme auf Josef Rudin (1969), André Haynal und andere (1987) sowie Taylor legt sie die Bestimmung von „Intensität“ der Fanbeziehung und „Wertschätzung“ des Fanobjekts als Grundlage ihrer Bewertung fest (Mackellar 2009: 9). Auch sie definiert am Ende vier Kategorien von Besuchern: „Socials“, „Dabblers“, „Fans“ und „Fanatics“ (ebd.: 11ff.). Diese Reihenfolge kann man auch als Hierarchie verstehen. Während „Socials“ eher ein bisschen Unterhaltung suchen, keine Fan-Utensilien tragen und nur wenig Expertenwissen über ihr Fanobjekt haben, legen „Fanatics“ ein quasi-religiöses Verhalten an den Tag, dass von dauerhafter, intensiver Bindung, hohem Aufwand und Ritualen geprägt ist. „Dabblers“ und „Fans“ sind als Stufen zwischen diesen Extremen zu verstehen (ebd.: 13ff.).
Auch wenn die Autoren unterschiedliche Ansätze und Begriffe wählen, lässt sich feststellen, dass in der Wissenschaft über die Klassifizierung von Zuschauern ein weitgehender Konsens besteht: Die Fans werden meist nach ihren Identifikationsgrad zum Fanobjekt, ihrem Aufwand für das Fanobjekt und ihrer Position in der Stadionhierarchie[4] gruppiert.
2.2.2 Schlussfolgerungen für diese Arbeit
Die Anwendung dieser Kategorisierungs-Modelle kann auf die Analyse der Fans von HSV und St. Pauli große Auswirkungen haben. So kann allein schon das Verhältnis von „Die-Hard“- zu „Fair-Weather Fans“ Aufschluss über den Identifikationsgrad einer Fangemeinschaft mit ihrem Fanobjekt geben. Außerdem ist es nun möglich, die Grundgesamtheit genauer zu definieren. So können beispielsweise reine „Sympathisanten“, die nicht ins Stadion gehen und auch keine Fan-Artikel kaufen oder den Verein in irgendeiner anderen Art wirtschaftlich unterstützen, aus einer Analyse ausgeschlossen werden. Dass ließe sich darüber lösen, dass nur die Fans befragt werden, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zum FC St. Pauli oder dem Hamburger SV als für sie externem Fanobjekt haben und dafür Zeit und Geld investieren. Dabei soll ein kleiner finanzieller Betrag ausreichen, der auch nicht unbedingt selbst geleistet werden muss. Beispiel: der Wunsch eines Grundschülers, zu Weihnachten ein HSV-Trikot zu bekommen.
2.3 Fans und Sozialisation
Hinter dem Vergleich zweier Fanszenen stehen aus sozialisationstheoretischer Perspektive zwei Fragen: Wie wird die Wahl des Fanobjekts beeinflusst, warum also wird ein Mensch Fan des Hamburger SV oder des FC St. Pauli? Und: Wie beeinflusst die Wahl des Fanobjekts möglicherweise den weiteren Lebensweg und das Handeln des Fans?
Dazu muss sich hier zunächst dem Begriff der Sozialisation genähert werden, der in den Geistes- und Sozialwissenschaften eine sehr lange Tradition hat und deshalb sehr weit ausdifferenziert ist. Anschließend wird erklärt, wie sich Fan-Sozialisation systematisch erforschen lässt. Grundlage dafür ist ein 2010 veröffentlichtes Modell von Jan Skrobanek und Solvejg Jobst, in dem die Ansätze vieler Theoretiker vereint sind. Anschließend soll ein Versuch gestartet werden, dieses Modell auf die konkrete Frage nach sozialwissenschaftlich relevanten Unterschieden zwischen HSV- und St.-Pauli-Fans anzuwenden.
2.3.1 Zum Verständnis des Begriffs „Sozialisation“
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Sozialisation laut Duden als „Prozess der Einordnung des [heranwachsenden] Individuums in die Gesellschaft u. die damit verbundene Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen“ verstanden (Duden 2001a: 933). Dieses Begriffsverständnis ist vor allem an die makrostrukturellen Modelle der älteren Sozialisationsforschung durkheimianischer Tradition angelehnt, die Sozialisation als „Einwirkungen der Erwachsenengeneration auf diejenigen, die noch nicht reif sind für das Leben in der Gesellschaft“ versteht (Durkheim 1972: 50).
Heutzutage ist der Blick auf diesen Prozess deutlich differenzierter.[5] Zahlreiche Wissenschaftler haben über Sozialisation nachgedacht, geforscht sowie veröffentlicht[6] und damit diesen Begriff weiterentwickelt. Durkheim entwickelte eine erste fundierte Definition, Sigmund Freud betont in seinen Ausführung den unbewussten Prozess der Internalisierung von Vorstellungen der Umwelt – und Talcott Parsons verband diese Erkenntnisse zu einem ersten integrativen Modell. Großen Einfluss hatten auch Peter L. Berger und Thomas Luckmann, George Herbert Mead, Jean Piaget, Pierre Bourdieu, Urie Bonfenbrenner, Klaus Hurrelmann und viele weitere Autoren. Weil ein Exkurs über die Entwicklung der Sozialisationsforschung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, soll es bezüglich eines tiefergehenden Überblicks bei einem Hinweis auf die für diese Arbeit genutzten Lehrbuchtexte von Albert Scherr (2002), Dieter Geulen (2007) und Matthias Grundmann (2010) belassen werden.
Festhalten lässt sich aber, dass im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs mehrheitlich für Modelle argumentiert wird, in denen Vergesellschaftung und Individuation auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung verknüpft werden (u.a. Scherr 2002: 46, Geulen 2007: 157, Grundmann 2010: 541). Exemplarisch sei hier Scherrs Zusammenfassung genannt, nach der die neuere Sozialisationsforschung fragt, „wie Individuen ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Handlungskompetenzen, Interessen und Persönlichkeitseigenschaften in Auseinandersetzung mit den jeweiligen sozialen Lebensbedingungen entwickeln“ (Scherr 2002: 46). Zudem benennt er vier Schwerpunkte der Sozialisationsforschung: Die „Stadien des Sozialisationsprozesses“ (u.a. Jugend), die „Dimensionen der Sozialisation“ (u.a. Identitätsbildung), die „Auswirkungen unterschiedlicher Sozialisationsbedingungen“ (u.a. Schichtzugehörigkeit) und die „Sozialisationsinstanzen“ (u.a. Familie) (ebd.: 48).
Auch Skrobanek und Jobst argumentieren auf dieser integrativen Linie. Sie wollen eine „theoretisch fundierte und empirisch abgesicherte Auseinandersetzung mit der Relation zwischen Gesellschaftsstruktur und der Persönlichkeitsentwicklung als Fan im Zeitverlauf“ auf den Weg bringen (Skrobanek/Jobst 2010: 222). Auch sie beziehen sich dabei auf die Arbeiten zahlreicher Sozialisationsforscher[7].
2.3.2 Das integrative Erklärungsmodell von Skrobanek/Jobst
Skrobanek und Jobst verstehen ihren Aufsatz als Grundlage der Verbindung von Sozialisations- und Fanforschung. Die Autoren definieren den Sozialisationsprozess als „lebenslangen Wirkungszusammenhang zwischen persönlicher Entwicklung und Gesellschaft“ und verstehen den Menschen als aktiven und kreativen Gestalter seiner Umwelt (ebd.: 207). Dabei beziehen sie sich auf das Mehrebenensystem von Urie Bronfenbrenner, dessen Modell „die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt als eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer Strukturen begreift, die als Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem bezeichnet werden“ (ebd.: 208).
Darüber hinaus soll Sozialisation im Zeitverlauf analysiert werden. Hier schließen sich Skrobanek und Jobst allerdings nicht direkt Bronfenbrenner an, der mit dem Chronosystem eine fünfte, zeitliche Dimension beschrieben hatte. Stattdessen argumentieren sie mit Berger und Luckmann, welche in primäre und sekundäre Sozialisation unterteilen. Demnach werden die Grundlagen für die Entwicklung einer Persönlichkeit in der Kindheit durch die Übernahme von „Rollen und Einstellungen der signifikanten Anderen“ (Berger/Luckmann 2010: 141) gelegt – Interaktionspartner sind meist Familienmitglieder wie Eltern, Großeltern und Geschwister. Im weiteren Verlauf des Lebens gewinnen dann Schule, Gleichaltrige und Medien an Einfluss (Skrobanek/Jobst 2010: 210).
Außerdem schließen die Autoren Bourdieus Habitus-Konzept in ihr Modell (siehe Abb. 2.1) ein, weil damit erklärt werden kann, wie soziale Strukturen durch Inkorporierung konserviert und dann durch erneute Externalisierung reproduziert werden (ebd.: 211ff.). Nach Bourdieu können Menschen, die im sozialen Raum auf einer ähnlichen Position verortet sind, auch einen ähnlichen Habitus entwickeln. (ebd.: 212). Und da der Habitus das Handeln strukturiert, kann es deshalb zu klassen-, schicht- oder feldtypischem Handeln kommen: Obwohl der Handelnde seine Handlungen als frei gewählt empfinden kann, sind sie abhängig von seiner Kapitalausstattung – zum Beispiel Geld, Wissen, körperlichen Fähigkeiten und sozialen Beziehungen (ebd.).
Zusammengefasst ist „die Entwicklung zum Fan ein pfadabhängiger Prozess“, der „durch die jeweiligen Wechselwirkungen der verschiedenen Sozialisationsebenen […] im Verlauf der primären und sekundären Sozialisation bestimmbar“ wird (ebd.: 213). Und die Strukturen werden dabei abhängig von „Interdependenzen der Sozialisationsphasen“ im Fan-Habitus inkorporiert (ebd.). Basierend auf den angeführten theoretischen Grundlagen haben Skrobanek/Jobst ein komplexes „Dynamisches Modell zur Erklärung von Ursachen und Wirkungen von Fantum“ entwickelt (ebd.: 221).
Abb. 2.1: Fans und Sozialisation: Erklärungsmodell von Skrobanek/Jobst
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Skrobanek/Jobst 2010: 221
Sie definieren zwei Analyseebenen: die fanspezifische Sozialisation auf mehreren Ebenen sowie die Fan-Sozialisation als Prozess. Auf der ersten Ebene werden die Wechselwirkungen mit den Mikro-, Makro, Meso- und Exosystemen hinterfragt:
Mikrosysteme sind Familien, Fangemeinschaften, Fanclubs et cetera. Diese Gruppen haben bestimmte Strukturen, denen der Fan ausgesetzt ist und die durch ihn reproduziert werden, sobald er sie inkorporiert hat. So könnte ein Fan bestimmte Normen und Werte einer Fangruppe übernehmen, weil er sich in dieser Fangruppe aufhält, und sie dann auch weitergeben. Nach Skrobanek und Jobst müssten auf der Mikroebene sowohl Habitus als auch individuelle Ausstattung mit ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital betrachtet werden. So sei abzuschätzen, „ob es sich beim Fantum um absichtsvolle Versuche der Jugendlichen zur produktiven Verarbeitung ihrer Situation oder um von ihnen nicht kontrollierbare Effekte der gegebenen Situation handelt“ (ebd.: 222).
Makrosysteme können nach Bourdieu als „soziale Räume mit sozialen Klassen und Machtbeziehungen“ verstanden werden (ebd.: 216). Skrobanek und Jobst bezeichnen sie auch als „Gelegenheitsstrukturen […], die Fantum ermöglichen bzw. fördern“ (ebd.: 221). Das betrifft die Versorgung des Fans mit ökonomischem Kapital, aber auch die Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen, Werte und Traditionen. Ein Beispiel wäre die traditionelle Verankerung des Fußballs in Deutschland als „Volkssport Nummer eins.“
Und bei der Analyse der Meso- und Exoebene stehen institutionelle Rahmenbedingungen, Netzwerke und klassenspezifische Herkunft im Fokus (ebd.: 221f.). Mesosysteme sind die „Beziehungen zwischen den Handelnden in der Fangemeinschaft und den weiteren Sozialisationsorten, in denen ein Fan agiert“ (ebd.: 215). Kapitalausstattung der Familie, regionale Herkunft und Einbettung in eine Peergruppe mit Fans des selben Objekts können Bedeutung des Fan-Seins sowie Integration in Region oder Peergruppe fördern (ebd.: 215). Und Exosysteme sind Felder, welche die Beziehung des Fans zum Fanobjekt betreffen, obwohl der Fan ihnen nicht angehört (ebd.: 215f.). Ein Beispiel wäre die Umwandlung von Steh- in Sitzplätze durch die Vereinsführung und der damit verbundene erhöhte Bedarf an ökonomischem Kapital, um das Fan-Sein ausleben zu können.
Diese erste Ebene der Analyse betrifft also mögliche Querschnitts-Differenzen zwischen verschiedenen Fanszenen. Auf der zweiten Ebene wird hingegen im Längsschnitt geforscht, damit kommen biografische Faktoren ins Spiel. So können außer der Stabilität der Beziehung zum Fanobjekt auch Entwicklungen des Fan-Habitus, langfristige Ursachen und Wirkungen der Mikro-, Makro-, Meso- und Exosysteme sowie Wechselwirkungen eines bestimmten Zeitabschnitts erkannt werden (ebd.: 219).
2.3.3 Ergänzungen zur Sozialstruktur
Geht es um Fan-Sozialisation, wird nicht nur bei Skrobanek und Jobst die Wechselwirkung von Fantum und Sozialstruktur betont. Deshalb scheint es sinnvoll, in dieser Arbeit noch einmal auf die Sozialstrukturanalyse einzugehen. Einen Überblick bietet hier Gunnar Otte, dessen Erkenntnisse die eben ausgeführte sozialisationstheoretische Argumentation bestärkt. Der Autor stellt fest, dass Fanobjektwahl und Fanpraxis durch Geschlechter-, Bildungs- und ethnische Kategorien, Generationen und räumliche Einheiten systematisch beeinflusst werden (Otte 2010: 69). Seine Überlegungen verstärkt er mit Erkenntnissen vorheriger Studien.[8] Kernannahmen sind, dass Fans ihre Fanobjekte „als Vorbilder und Identitätsstifter verehren, die den Interessen ihrer Lebensführung entsprechen“ und die Lebensführung so ausgestaltet ist, dass sie auf Anerkennung in den persönlichen Netzwerken der Akteure stößt“ (ebd.: 100).
Otte fasst unter Bezugnahme auf Thomas Klein (2005) und Rainer Geißler (2008) zusammen, dass heute „die Position im vertikalen Schichtungsgefüge – festgemacht an Erwerbsstatus, Beruf, Bildung und Einkommen –, die Zugehörigkeit zu Geschlechter- und ethnischen Kategorien sowie zu demographischen (Altersgruppen und Generationen) und familialen (Familien- bzw. Lebensformen) Kategorien“ und deren Auswirkungen auf das soziale Handeln bei der Sozialstrukturanalyse besondere Bedeutung beigemessen wird (ebd.: 70). Im Gegensatz dazu erfrage die Lebensstilforschung auf Basis der Individualisierungsthese „kollektiv geteilte Subjektivität wie latente Wertorientierungen, Mentalitäten, Habitusformen, Geschmacksmuster, expressive Lebensstile, Praktiken der Alltagsgestaltung – zusammen: Lebensführung“ (ebd.: 71). Der Autor empfiehlt schließlich eine kombinierte Analyse auf vertikaler und horizontaler Ebene: „Objektive und subjektive Dimensionen sozialer Ungleichheit hängen in beträchtlichem Ausmaß zusammen und stehen in einem Ergänzungs-, nicht Ersetzungsverhältnis“ (ebd.: 71).
Nach Otte werden der Zugehörigkeit zu sozialen Kategorien vier Wirkungsmechanismen unterstellt: (1) Sozialisation und soziale Identität, (1) Netzwerkhomogenität, (3) Einfluss durch ökonomische und kulturelle Ressourcen und Restriktionen sowie (4) durch Opportunitätsstrukturen (ebd.: 72f.). Diese Wirkungsmechanismen sind auch im Modell von Skrobanek und Jobst zu erkennen.
Sozialisation und soziale Identität meint hier, dass sich Anregungen der ersten Lebensjahre im Habitus verfestigen und identitätsbildend sind. Mit Netzwerkhomogenität spricht der Autor Erkenntnisse an, nach denen „gleich und gleich sich gern gesellt“ – auf Ebene von Lebensführung und vertikaler Sozialstruktur (ebd.: 73). Mit Ressourcen und Restriktionen meint er, dass die von Bourdieu definierten Kapitalsorten, vor allem ökonomisches und kulturelles Kapital, auf Sozialstruktur Einfluss nehmen (ebd.). Und Opportunitätsstrukturen sind das, was Skrobanek/Jobst als Makrosysteme bezeichnen: „Durch die Zugehörigkeit zu räumlichen Kategorien […] und zeitlichen Lagerungen (Generationen) sind Akteure mit einer Infrastruktur konfrontiert, im Rahmen derer sie ihre Lebensführung gestalten“ (73). Für seine Analyse entwickelt Otte ein Modell, dass Sozialstruktur und Fantum auf der Ebene der „Lebensführung als Vermittlungsinstanz“ verbindet (siehe Abb. 2.2).
Abb. 2.2: Fans und Sozialstruktur: Erklärungsmodell von Otte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Otte 2010: 78
Demnach matchen also Sozialstruktur und Fanobjekt, weil die Sozialstruktur (Ungleichheit, Differenzierung) sich auf die Lebensführung auswirkt und die Lebensführung (Wertorientierung, Lebensstil) die Wahl des Fanobjekts beeinflusst: „Diese Passung ist primär durch Homophilie gekennzeichnet“ (ebd.: 78). Damit überträgt Otte das Homophilieprinzip[9] von sozialen auf parasoziale Beziehungen.
2.3.4 Ergänzungen zur Lebensstil- und Milieuforschung
Wie in dem Modell von Otte aufgezeigt, können auch die Wahl des Fanobjekts und der Lebensstil des jeweiligen Fans voneinander abhängen. Hradil definiert Lebensstil als „regelmäßig wiederkehrenden Gesamtzusammenhang von Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbeständen und bewertenden Einstellungen eines Menschen“ (Hradil 1999, S. 431). Es geht bei Lebensstil-Konzepten also nicht nur um die Analyse vertikaler Ungleichheit, sondern auch um Unterschiede im Alltags- oder Konsumverhalten. Hradil geht dabei davon aus, dass die Lebensweisen der Menschen von objektiven Bedingungen beeinflusst, aber nicht komplett bestimmt werden (ebd.).
Nun kann in dieser Arbeit nicht ausführlich auf alle Aspekte der Lebensstilforschung eingegangen werden. Deshalb sollen ihre Möglichkeiten hier an einem Beispiel dargestellt werden: dem Modell der Sinus-Milieus, das im deutschsprachigen Raum seit 2001 stark an Bedeutung gewonnen hat und mit dem Menschen nach sozialer Lage, Wertorientierung sowie Lebensweise in den Feldern Arbeit, Familie, Freizeit und Konsum gruppiert werden[10].
Derzeit sind zehn verschiedene Milieus definiert: konservativ-etabliertes Milieu (klassisches Establishment), traditionelles Milieu (Kleinbürger und Arbeiter mit großem Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis), liberal-intellektuelles Milieu (Bildungselite mit hohem Individualitätsbedürfnis), sozialökologisches Milieu („politisch korrekte“ Idealisten, Konsumkritiker), Bürgerliche Mitte (leistungsbereiter Mainstream), prekäres Milieu (Unterschicht mit schlechten Perspektiven), Milieu der Performer (Leistungselite mit Avantgarde-Anspruch), adaptiv-pragmatisches Milieu (mobile, zielstrebige junge Mitte), Hedonistisches Milieu (Spaßorientierte Leistungsverweigerer), Expeditives Milieu (individualistisch geprägte digitale Avantgarde) (siehe Abb. 2.3).
Abb. 2.3: Sinus-Milieus in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: INTEGRAL (http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html)
2.3.5 Schlussfolgerungen für diese Arbeit
Die Argumentation anhand der Ausarbeitungen von Skrobanek/Jobst und Otte hat aufgezeigt, dass mögliche Wechselwirkungen sozialer Strukturen und sozialen Handelns in Bezug auf die Beziehung zu einem sozial konstruierten Fanobjekt untersuchbar sind. Zwar sind die Modelle der Autoren vor allem darauf ausgelegt, zwischen allgemeineren Fanszenen (zum Beispiel Fußballfans und Musikfans) zu unterscheiden. Eine Übertragung auf die Fanszenen zweier Fußball-Vereine ist aber durchaus möglich, wenn die sozial konstruierten Bedeutungen der Fanobjekte große Differenzen aufweisen.
Das ist bei Vereinen wie Borussia Dortmund und Schalke 04 nicht der Fall: Hier handelt es sich jeweils um Clubs, die als identitätsstiftendes und vergemeinschaftendes Symbol ihrer jeweiligen Stadt gedeutet werden. Dieser Prozess wird auch durch die Entstehung einer globalen Medienlandschaft und der damit verbundenen Erzeugung imaginärer entlokalisierter Fangemeinschaften nicht unbedingt entwertet: „Lokale Bezüge mögen sogar durch die Medienberichterstattung gestärkt werden, etwa indem in der Berichterstattung über Vereine deren regionale Traditionen thematisiert werden“ (Ohr 2010: 343). Nach Gabriele Klein kann ein Fußball-Verein auch „identifikatorischer Platzhalter des Lokalen“ sein (Klein 2008: 31).
Beim FC St. Pauli und dem Hamburger SV deuten Literatur, Medien und auch das Verhalten der Fans auf sozial konstruierte Zuschreibungen hin, die sich nicht nur auf regionale Verortung beziehen. Im folgenden Kapitel wird nun zunächst der Versuch einer Systematisierung der vielen, bisher ungeordneten Erkenntnisse gestartet. Im Anschluss soll aufgezeigt werden, wie die im Diskurs befindlichen soziokulturellen Differenzen zwischen den Fanszenen der beiden Hamburger Profi-Vereine überprüft werden können.
3. HSV und St. Pauli – eine besondere Rivalität
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, haben Lokalrivalitäten häufig ihren Ursprung in langfristiger sportlicher Konkurrenz. So kämpften Borussia Dortmund und Schalke 04 seit Ende der 1950er Jahre bis heute[11] um die Vorherrschaft im Ruhrgebiet. Schon vor mehr als 90 Jahren wurde die Feindschaft zwischen dem 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Fürth[12] begründet, als diese beiden Clubs zwischen 1920 und 1929 zusammen sieben deutsche Meisterschaften gewannen. In München war nach dem Krieg lange Zeit der TSV 1860 der erfolgreichere Verein[13], ehe der FC Bayern 1969 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft an den „Löwen“ vorbeizog.
In Hamburg aber sieht das anders aus: Beim Blick auf die unterschiedliche Entwicklung beider Clubs wird deutlich, dass die Rivalität zwischen den Fans des FC St. Pauli und denen des HSV eine besondere Note haben muss. Grundlage der Argumentation ist hierbei, dass es sich beim Vergleich der Clubs mit Ausnahme ganz kurzer Phasen eben nicht um ein Duell zweier sportlich konkurrierender Vereine handelt. Für die Fans des „kleinen“ FC St. Pauli mag das als Herausforderer des großen Nachbarn noch interessant sein. Vor allem die HSV-Fans aber schlagen die Möglichkeit einer klassischen, regional verorteten Fan-Rivalität zu einem gleichwertigen Gegner aus, indem sie anscheinend der Konkurrenz zum FC St. Pauli eine größere Bedeutung beimessen als der Konkurrenz zum SV Werder Bremen.
3.1 Sportlich und wirtschaftlich ein Duell „Groß gegen Klein“
Egal, ob sportlich oder wirtschaftlich: Der HSV ist in Hamburg bisher der erfolgreichste Fußball-Verein. Das belegen Titelgewinne, Ligazugehörigkeit, Tabellenplätze, Jahresumsatz sowie Zuschauer- und Mitgliederzahlen.
Seit seiner Gründung 1919[14] spielt der HSV durchgehend in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Club gewann sechs deutsche Meisterschaften, dreimal den deutschen Pokal und zweimal den Europapokal. 28 Mal gelang die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb, in der jüngsten Erfolgsphase von 2003 bis 2010 sogar sieben Mal in Folge. Und auch vor der Gründung der Bundesliga war der HSV über weite Strecken der dominierende Club in der Stadt: Von 1948 bis 1963 holten die Fußballer vom Rothenbaum stets den Meistertitel der Oberliga Nord – außer 1954, als sie nur Elfter wurden und sogar den Abstieg fürchten mussten. Dies war nach 1947 das zweite und bis heute letzte Mal, dass der FC St. Pauli in der Liga am Saisonende eine höhere Platzierung als der HSV erreichte.
Der FC St. Pauli blickt auf eine deutlich wechselhaftere Geschichte zurück. 1924[15] vom Hamburg-St. Pauli TV abgelöst, begann der Verein zunächst in der Norddeutschen Liga – damals die höchste deutsche Spielklasse. Es folgten insgesamt 27 Auf- und Abstiege, zweimal (1979 bis 1984 sowie 2003 bis 2007) rutschte der Verein sogar in die Drittklassigkeit ab. Als größte Erfolge des Clubs gelten die Halbfinalteilnahme im Kampf um die deutsche Meisterschaft 1948, die fünf Aufstiege in die Bundesliga (1977, 1988, 1995, 2001, 2010) sowie und der Halbfinal-Einzug als Regionalligist im DFB-Pokal 2006. Außerdem werden in diesem Zuge häufig der 2:1-Erfolg am 6. Februar 2002 gegen den FC Bayern München (Niegel 2010: 61) und der 1:0-Auswärtssieg am 16. Februar 2011 beim Stadtrivalen HSV angegeben. Die dürften allerdings eher als Hinweise auf Fankultur, Mythenbildung und Marketing-Strategie des FC St. Pauli denn als ernsthafte sportliche Erfolge gewertet werden.
Zweimal hat der FC St. Pauli bisher an der Vormachtstellung des HSV in der Hansestadt gekratzt: Zwischen 1946 und 1954, als sich die damalige „Wunderelf“ regelmäßig für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizierte (Martens 2002: 55ff.). Und zwischen 1988 und 1991[16], als der Hamburger SV in seiner bisher größten Krise steckte und daran beinahe zugrunde gegangen wäre (Skretny/Prüß 2008: 327). Seitdem aber ist an der Hierarchie an der Elbe nicht zu rütteln. Daran ändert auch St. Paulis Derbysieg[17] von 2011 nichts: Während der HSV am Saisonende Rang acht belegte, stieg der Aufsteiger vom Heiligengeistfeld wieder ab.
Und auch wirtschaftlich liegen die beiden Hamburger Clubs weit auseinander, wenngleich der FC St. Pauli hier zuletzt stark aufgeholt hat (siehe Abb. 3.1). Nach dem Abstieg in die Regionalliga hatte der FC St. Pauli die Saison 2003/04 mit 4,64 Millionen Euro bestreiten müssen, während der HSV Einnahmen in Höhe von 70 Millionen Euro verbuchte. 2008/09 war der Unterschied noch eklatanter: Europapokal-Halbfinalist HSV verzeichnete mit 188,6 Millionen Euro einen Rekordumsatz, Zweitligist FC St. Pauli musste mit 18 Millionen Euro klarkommen. Zwei Jahre später sind die beiden Clubs viel deutlicher zusammengerückt (HSV: 128,8 Millionen Euro / FC St. Pauli: 40,0 Millionen Euro). Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte – angesichts der aktuellen finanziellen Verluste beim HSV (abendblatt.de 16.12.2011) und positiver wirtschaftlicher Schlagzeilen vom Millerntor (abendblatt.de 03.11.2011). Dass der Verein Ende 2011 innerhalb weniger Wochen an seine Fans Anleihen in Höhe von acht Millionen Euro verkauft hat, deutet zumindest auf großes finanzielles Potenzial im Umfeld des FC St. Pauli hin (manager magazin online 10.05.2012).
Abb. 3.1: Umsatz-Entwicklung beim Hamburger SV und dem FC St. Pauli
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Datensammlung auf Basis von Vereinsangaben
Eine große Geldquelle von Profi-Vereinen sind die Zuschauer bei Heimspielen, weil sie für Eintrittsgeld bezahlen und den Club für Sponsoren interessant machen. Und auch hier ist der HSV gegenüber dem FC St. Pauli klar im Vorteil. Mit Ausnahme der Saison 1988/89 hatte er seit Einführung der Bundesliga 1963 stets den höheren Zuschauerschnitt (siehe Abb. 3.2). Besonders eklatant war der Unterschied zwischen 1978 und 1984: Während zu dieser Zeit durchschnittlich mehr als 30.000 Fans ins Volksparkstadion pilgerten, blieb der Lokalrivale in vier Spielzeiten sogar unter der 2.000er-Marke. Die Zahlen belegen, dass der FC St. Pauli sechs Jahre lang nur über sehr wenig Anhänger verfügte, die auch ins Stadion gegangen sind. Dann veränderte sich die Publikumsstruktur des Clubs radikal, sodass der Zuschauerzuspruch sprunghaft anstieg[18]. Von 1988 bis 1997 hatte man bei diesem Vergleich so etwas wie Tuchfühlung zum HSV. Danach aber begann dieser mit dem Umbau des Volksparkstadions – und damit stiegen die Besucherzahlen in bisher unerreichte Höhen. Seit 2005 liegt der HSV im Zuschauerschnitt stets jenseits der 50.000 – ein Wert, den der FC St. Pauli schon aufgrund des deutlich kleineren Stadions (Saison 2011/12: 24.350 Plätze) nicht erreichen kann.
Abb. 3.2: Entwicklung der Zuschauerzahlen beim Hamburger SV und dem FC St. Pauli
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: Eigene Datensammlung aufgrund von Vereinsangaben
Ebenso deutlich unterscheiden sich die Vereine beim Vergleich der Mitgliederzahlen. Am 1. März 2012 gehörten dem HSV 70.920 Menschen an, 54.673 davon zählen zur Abteilung der „Supporters“, die dem Verein nicht als aktive Sportler, sondern als Fans des Bundesligateams angehören (HSV 01.03.2012). Das ist allerdings eine jüngere Entwicklung: Allein zwischen dem Sommer 2004 und dem Sommer 2010 sind dem HSV 50.100 Mitglieder beigetreten. Beim FC St. Pauli sieht die Entwicklung ähnlich aus, nur eben eine Nummer kleiner. Von 1984 bis 1999 hatte sich die Mitgliederzahl auf 2.200 verdoppelt, im September 2011 lag sie bereits bei 15.191 (FC St. Pauli 25.06.2012). Davon gehört ebenfalls ein Großteil den Nicht-Aktiven an: Mehr als 9.000 sind in der Abteilung Fördernde Mitglieder (AFM) organisiert.
[...]
[1] Moderator, Autor, Journalist und Stadionsprecher von Werder Bremen. Sportjournalist des Jahres 2011.
[2] Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Nyla R. Branscombe und Daniel L. Wann, die nach der Stärke der Identifikation mit dem Fanobjekt fragen und dann in „Die-Hard Fans“ und „Fair-Weather Fans“ unterscheiden (Wann/Branscombe 1990: 103ff.).
[3] Dabei argumentiert er vor allem unter Bezugnahme auf Erkenntnisse von Raymond Williams (1961), Ian Taylor (1971) and Chas Critcher (1979), dass es in den vergangenen Jahrzehnten im Spitzenfußball zu extremen Veränderungen („hypercommodification“) gekommen sei, die sich auf die Zuschauerstruktur ausgewirkt haben (Giulianotti 2002: 25). Demnach hat in Großbritannien schon in den 1960er Jahren ein Prozess eingesetzt, in dem für lokale Identifikation, aktive Teilnahme und ergebnisorientierten Fans aus der Arbeiterklasse verdrängt wurden durch Zuschauer aus der Mittelkasse und deren Interesse „in family football, spectacle, skill, and performative efficiency“ (ebd. 2002: 27). In den 1980er Jahren wurde diese „Bourgeosifizierung“ dann noch einmal beschleunigt, als der Profifußball innerhalb von kurzer Zeit zum Milliardengeschäft wurde (ebd.: 29).
[4] Das kann sowohl die finanzielle Hierarchie (teurer Sitzplatz in der VIP-Loge oder günstiger Stehplatz in der Fankurve?) als auch die Hierarchie in der Kurve (Wer bestimmt, wann welche Schlachtrufe und Gesänge angestimmt werden? Wer gilt beispielsweise durch Gewalthandlungen oder -androhungen als Anführer in einem bestimmten Zuschauerblock?) betreffen.
[5] Das kann auch daran liegen, dass sich nicht nur die Soziologie, sondern auch die Psychologie, Pädagogik, Anthropologie und weitere Wissenschaftsdisziplinen mit dieser Thematik beschäftigen. Klaus Hurrelmann und Dieter Ulich veröffentlichten bereits 1980 unter dem Titel „Handbuch der Sozialisationsforschung“ ein Werk, an dem insgesamt 34 Autoren verschiedener Disziplinen beteiligt waren.
[6] So veröffentlichte der englische Philosoph Thomas Hobbes bereits 1651 im „Leviathan“ eine Theorie, nach der das Funktionieren einer aus vielen Egoisten bestehenden Gesellschaft durch einen übermächtigen Staat erzwungen werden muss – Jahrhunderte, bevor der Begriff Sozialisation geprägt wurde (Geulen 2007: 143).
[7] u.a. Hurrelmann, Parsons, Bourdieu, Hartmut M. Griese, Bronfenbrenner, Berger und Luckmann.
[8] u.a. Schlagenhauf (1977), Guttmann (1986), Stollenwerk (1996), Mehus (2005). Pilz (2006)
[9] Bevorzugung „ähnlicher“ Personen bei der Bildung von persönlicher Netzwerke
[10] Die Bezeichnung „Sinus-Milieus“ wurde von der Firma Sinus Sociovision markenrechtlich geschützt. Das Konzept wird vor allem in Marketing und Marktforschung eingesetzt.
[11] Mit ein paar Unterbrechungen: Dortmund war von 1972 bis 1976 zweitklassig, Schalke pendelte von 1981 bis 1991 zwischen 1. und 2. Bundesliga.
[12] heute: SpVgg Greuther Fürth
[13] u.a. Gründungsmitglied der Bundesliga 1963, Europapokalsieger 1965, deutscher Meister 1966
[14] Das offizielle Gründungsdatum des HSV ist der 29. September 1887. An diesem Tag wurde mit dem SC Germania der älteste Vorgängerverein gegründet. Unter „Hamburger Sport-Verein“ firmierte der Club erstmals am 3. Februar 1914, kurz darauf folgte aber die Umbenennung in „Kriegsvereinigung Victoria-Hamburg 88“. Nach dem Zusammenschluss von FC Falke, Hamburger FC und SC Germania wurde schließlich am 12. Juli 1919 der Clubname „Hamburger Sport-Verein e.V.“ beim Amtsgericht ins Vereinsregister eingetragen.
[15] Auch der FC St. Pauli hat auf seinem Briefkopf ein früheres Gründungsdatum stehen: 15. Mai 1910. Damals bildeten die Fußballer aber nur eine Abteilung des Hamburg-St. Pauli TV. Die Ablösung vom Mutterverein und Eintragung als „Fußball-Club St. Pauli“ erfolgte jedoch erst 1924, als das Verbot der Doppelmitgliedschaften von Vereinen im Deutschen Fußball-Bund und in der Deutschen Turnerschaft umgesetzt wurde.
[16] In der Saison 1988/89 verschenkte St. Pauli die große Chance, den punktgleichen Stadtrivalen zum dritten Mal hinter sich zu lassen: Durch ein 0:7 am letzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf fiel St. Pauli doch noch hinter den HSV zurück.
[17] In diesem Zusammenhang lässt sich zumindest über den Begriff „Stadtmeister“ streiten. Während seitens des FC St. Pauli dieser inoffizielle Titel aufgrund der Bilanz in den direkten Duellen (1 Sieg, 1 Remis) beansprucht wird, beruft sich der HSV auf die bessere Platzierung am Saisonende.
[18] Siehe Kapitel 3.3.2
Details
- Titel
- Die Fans vom Hamburger SV und dem FC St. Pauli im Vergleich: Eine sozialisationstheoretische Analyse
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 66
- Katalognummer
- V297214
- ISBN (Buch)
- 9783955493271
- ISBN (PDF)
- 9783955498276
- Dateigröße
- 1247 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Fußball Ultrà Sozialisation soziokulturell Sportsoziologie Fangemeinschaft sozialstrukturell
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2012, Die Fans vom Hamburger SV und dem FC St. Pauli im Vergleich: Eine sozialisationstheoretische Analyse, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/297214
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.