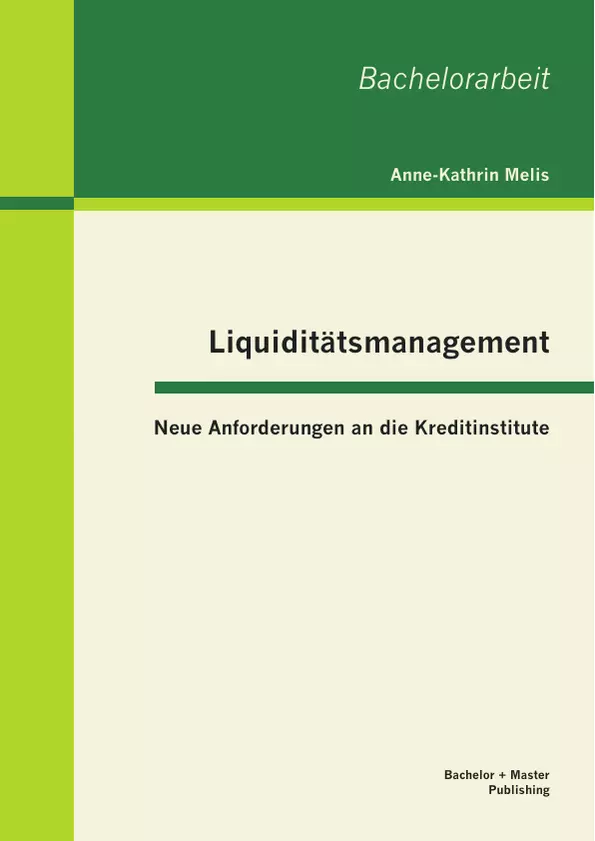Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos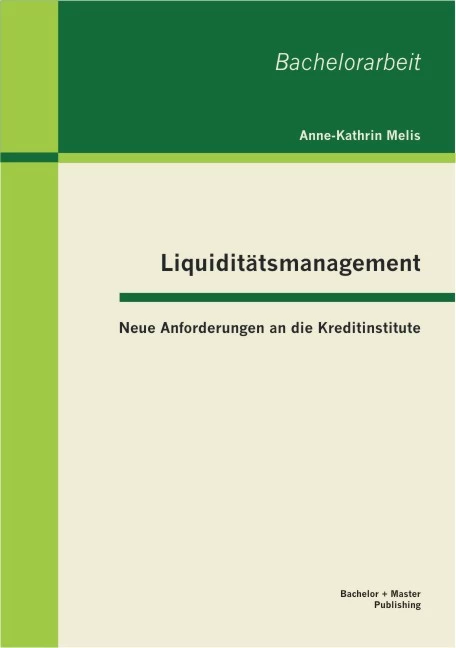
Liquiditätsmanagement: Neue Anforderungen an die Kreditinstitute
Bachelorarbeit, 2012, 47 Seiten
Autor

Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Fachhochschule Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung
Note
1
Leseprobe
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die Einteilung der Liquiditätsrisiken
Abbildung 2: Bilanzbild nach Anwendung der Goldenen Bankregel
Abbildung 3: Schematischer Zielkonflikt zwischen Gewinn und Liquidität
Abbildung 4: Die Einteilung der Laufzeitbänder
Abbildung 5: Umstrukturierung der Aktivseite durch die LCR
Abbildung 6: Einschränkung der Fristentransformation durch die NSFR
Abbildung 7: Liquiditätsspreads ausgewählter Kreditinstitute
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zeitplan der Einführung der Kennzahlen
1 Einleitung
Banken sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamtwirtschaft. Als Finanzintermediär vermitteln sie zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern und erfüllen verschiedene Transformationsfunktionen. So sind sie z.B. durch Fristentransformation in der Lage zumeist langfristige Kredite zu vergeben, obwohl die Laufzeit von hereingenommenen Einlagen tendenziell eher kurzfristig ist.[1] Wann genau jedoch die Zahlungsströme fließen ist trotz gegebenenfalls vorhandener vertraglicher Laufzeiten kaum abschätzbar, da Kunden z.B. vorzeitige Kündigungsrechte geltend machen können. Banken gehen daher ganz bewusst aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Funktion gewisse Liquiditätsrisiken ein. Auf lange Sicht müssen die Zahlungsmittelzu- und Zahlungsmittelabflüsse sich jedoch ausgleichen, denn Liquidität ist eine zwingende Voraussetzung für die Existenz jeglicher Unternehmen und somit auch für Banken. Ein funktionierendes Liquiditätsmanagement zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit ist daher als Teil der Gesamtbanksteuerung unerlässlich.
Der Umgang mit Liquidität befindet sich jedoch seit einigen Jahren in einem ständigen Wandel. Das Liquiditätsrisiko und dessen Steuerung sind vor allem durch die Turbu-lenzen auf dem Finanzmarkt infolge der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 stärker in den Fokus der Regulierung gerückt. Seit 2008 werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Liquiditätsmanagement daher sukzessive überarbeitet und weiterentwickelt.[2] Um die Veränderungen im Umgang mit Liquidität aufzuzeigen, werden in Abschnitt 2 zu Beginn einige Grundlagen dargestellt. Neben der besonderen Bedeutung des Liquiditätsrisikos für Banken werden zunächst die Anfänge der Liquiditätsüberlegungen im Sinne der klassischen Theorien erläutert. In diesem Zusammenhang werden zudem die Anforderungen aus betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht als Rahmenbedingungen für das Liquiditätsmanagement dargestellt. Im dritten Abschnitt wird dann im Folgenden auf die Entwicklungen während und nach der Finanzkrise eingegangen, um darauf aufbauend die neuen Regulierungsentwürfe der Bankenaufsicht vorzustellen. Abschließend werden die möglichen Auswirkungen dieser neuen Regulierungen auf den Bankensektor diskutiert und ein Ausblick auf den möglichen Fortgang der Entwicklungen im Liquiditäts-management gegeben. Inwiefern hat sich das Liquiditätsmanagement insgesamt verändert?
2 Grundlagen des Liquiditätsmanagements
2.1 Das Liquiditätsrisiko im Bankbetrieb
Als liquide gelten solche Wirtschaftssubjekte, die in der Lage sind, ihren Zahlungs-verpflichtungen fristgerecht und vollständig nachzukommen.[3] Vereinfachend gesagt ist dies der Fall, wenn die vorhandenen Zahlungsmittel dem Zahlungsmittelbedarf in jedem Zeitpunkt mindestens entsprechen, d.h. ein finanzielles Gleichgewicht herrscht.[4] Das Risiko besteht in diesem Zusammenhang also darin, dass der tatsächliche Zahlungsmittelbedarf größer ist als geplant. Folgende Gleichung soll diesen Sach-verhalt verdeutlichen[5]:
Zahlungsmittel + Liquidationserlöse + Refinanzierungszuflüsse ≥ Zahlungsmittelbedarf.
Alle diese Komponenten beinhalten jedoch Liquiditätsrisiken, welche die verschie-densten Ursachen und Wirkungszusammenhänge haben können. Daher ist zunächst eine grobe Unterteilung notwendig (vgl. Abbildung 1). So unterscheidet man z.B. zwischen originären und derivativen, d.h. aus anderen Risiken abgeleiteten oder resultierenden Liquiditätsrisiken. Im Folgenden wird jedoch nur kurz auf die wichtigsten Arten der originären Liquiditätsrisiken eingegangen. Diese umfassen das so genannte Liquiditätsanspannungsrisiko[6], das Terminrisiko sowie das Abrufrisiko. Während es sich beim Liquiditätsanspannungsrisiko um eine langfristige strukturelle Komponente des Liquiditätsrisikos handelt, beziehen sich das Termin- und das Abrufrisiko eher auf die kurzfristige Disposition von Liquidität zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungs-fähigkeit.[7] Das Liquiditätsanspannungsrisiko beschreibt die Gefahr, dass Positionen gar nicht mehr oder nur noch zu sehr ungünstigen Marktpreisen veräußert werden können. Dieses Risiko hat, wie später noch dargestellt, im Zusammenhang mit Verbriefungen eine wichtige Rolle während der Finanzkrise 2007 gespielt. Das Liquiditätsanspannungsrisiko beinhaltet jedoch auch ein Refinanzierungsrisiko im engeren Sinne. Da Banken über einen Zugang zum Geldmarkt verfügen, können sich diese in der Regel kurzfristig mit Liquidität eindecken, sobald ein Zahlungsmittelbedarf entsteht. Hier besteht jedoch das Risiko, dass die kurzfristige Aufnahme von Zahlungsmitteln nicht oder nur noch zu erhöhten Konditionen möglich ist.[8] Beim Terminrisiko handelt es sich um das Risiko, welches vor allem aus nicht fristgerechten Zahlungen resultiert. Das Abrufrisiko hingegen besteht in der Gefahr, dass Kunden unerwartet die ihnen zugesagten Kreditlinien in Anspruch nehmen oder ihre Einlagen vorzeitig abziehen.[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die Einteilung der Liquiditätsrisiken
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schierenbeck, H. / Lister, M. / Kirmße, S. (2008), S. 514.
Ausreichende Liquidität ist in jedem Unternehmen wichtig und notwendig. Im Bankbetrieb kommt dieser jedoch aufgrund verschiedener Faktoren eine besondere Bedeutung zu. Man unterscheidet hier zwischen exogenen und endogenen Einfluss-faktoren. Während exogene Faktoren aus der besonderen Stellung der Kreditinstitute in der Volkswirtschaft resultieren, entstehen endogene Faktoren durch die besondere Form der bankbetrieblichen Leistungserstellung.[10] Liquiditätsrisiken ergeben sich vor allem aus den verschiedenen Transformationsfunktionen einer Bank.[11] Hierzu zählen insbesondere die Losgrößen- und die Fristentransformation. Die Losgrößentrans-formation beinhaltet die Aufgabe, für eine betragsmäßige Übereinstimmung von Kapitalangebot und -nachfrage auf dem Finanzmarkt zu sorgen. Durch die Fristen-transformation hingegen werden die Zeiträume bzw. Laufzeiten der Kapitalüberlassung und dessen Aufnahme zum Ausgleich gebracht. Ein weiterer Grund für die Besonderheit der Liquidität im Bankbetrieb ist die Notwendigkeit, Zahlungsbegehren von Kunden nahezu zeitlich unbegrenzt und der Höhe nach ungewiss erfüllen zu müssen. Kreditinstitute leben vor allem vom Vertrauen ihrer Kunden. Würden sie Zahlungsaufforderungen nicht unverzüglich nachkommen, kann dies die Kunden an deren Vertrauenswürdigkeit zweifeln lassen (sog. Reputationsrisiko). Schlimmstenfalls kann es hierdurch zu einem so genannten „Bank Run“ kommen. Hierunter versteht man den plötzlichen Abzug aller Einlagen bei Fälligkeit oder gegebenenfalls auch früher. Nach dem Prinzip einer „Self Fullfilling Prophecy“ kann die Bank dadurch tatsächlich in einen Liquiditätsengpass geraten.[12]
Alle diese Beispiele machen deutlich, wie wichtig die Steuerung von Liquiditätsrisiken als Teil des Bankmanagements ist. Als grundlegend hierfür ist jedoch das Liquiditäts-management an sich zu sehen, welches die Aufgabe hat sicherzustellen, dass das Kreditinstitut jederzeit in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.[13]
2.2 Die klassischen Liquiditätstheorien als Ausgangspunkt
Um die grundlegenden Ideen hinter den heutigen Methoden des Liquiditätsmanage-ments zu verstehen ist es wichtig, die klassischen Liquiditätstheorien zu kennen. Sie bilden die Basis im ständigen Weiterentwicklungsprozess und werden daher im Folgenden kurz dargestellt.
Ein erster Ansatz zur Liquiditätsausstattung von Banken wurde bereits im Jahr 1854 vom Statistiker und Volkswirt O. Hübner formuliert: „Der Credit, welchen eine Bank geben kann, ohne Gefahr zu laufen, ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllen zu können, muß nicht nur im Betrage, sondern auch in der Qualität dem Credite entsprechen, welchen sie genießt.“[14] Diese so genannte Goldene Bankregel verlangt von den Banken eine vollständige Fristenkongruenz, d.h. Aktiv- und Passivgeschäfte müssen hinsichtlich Betrag und Qualität identisch sein. Mit Qualität ist hier insbesondere die Fristigkeit gemeint.[15] Bilanziell gesehen würde sich diese Forderung wie in Abbildung 2 dargestellt auf das Bankgeschäft auswirken. Sichteinlagen und andere täglich fällige Gelder müssten entweder durch das Kassenvolumen oder andere sofort verfügbare Vermögensgegenstände gedeckt sein. Bei den Sichteinlagen handelt es sich insbesondere um Guthaben der Kunden auf Girokonten, über welches der Kunde täglich im Rahmen seines Guthabens verfügen kann. Ein Kredit mit sechsmonatiger Laufzeit müsste demnach durch eine Verbindlichkeit über sechs Monate finanziert sein. Hierbei könnte es sich z. B. um eine Kundeneinlage in Form eines Festgeldes mit einer entsprechenden Laufzeit handeln. Langfristige und somit risikoreichere Anlagen wie beispielsweise Immobilien als Sachanlagen müssten durch Eigenkapital finanziert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Bilanzbild nach Anwendung der Goldenen Bankregel
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pohl, M. (2008), S. 41.
Es gibt jedoch einige Kritik im Hinblick auf die Goldene Bankregel. Wenn die Bank nach dieser Empfehlung handeln würde, so könnte sie den verschiedenen Bedürf-nissen der Kunden nicht mehr gerecht werden. Eine vollständige Fristenkongruenz würde bedeuten, dass Kredite nur mit Laufzeiten vergeben werden können, für die Kunden der Bank Einlagen zur Verfügung gestellt haben. Dass Kapitalangebot und Kapitalnachfrage in diesem Zusammenhang jemals genau übereinstimmen ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Um den unterschiedlichen Wünschen der Kunden nach-kommen zu können, muss eine Bank also zwangsweise Fristentransformation betreiben. Zudem hat sich gezeigt, dass eine vollständige Fristenkongruenz von Aktiv- und Passivseite auf Grund verschiedener anderer Refinanzierungsmöglichkeiten[16] überhaupt nicht notwendig und somit ökonomisch keinesfalls sinnvoll ist. Des Weiteren werden selbst durch diese restriktiv wirkende Bedingung nicht alle Aspekte des Liquiditätsrisikos abgesichert. So besteht weiterhin das Risiko, dass Zahlungen nicht fristgerecht eingehen (Terminrisiko) oder Einlagen vorzeitig abgezogen werden. Außerdem werden sowohl Aktiv- als auch Passivgeschäfte, d.h. Einlagen und Kredite oft verlängert.[17] Insbesondere Sichteinlagen verbleiben trotz der täglichen Fälligkeit in der Regel länger als einen Tag auf dem Konto. Dieser Ansatz sowie die genannten Kritikpunkte haben zur Entwicklung der so genannten Bodensatztheorie geführt.
Die Bodensatztheorie basiert auf der Annahme, dass bei Einlagen ein gewisser Bodensatz unabhängig von deren formaler Laufzeit langfristig zur Verfügung steht. Sie geht auf den deutschen Ökonom und Finanzwissenschaftler A. Wagner zurück.[18] Anhand von Erfahrungswerten, aber auch statistisch lässt sich zeigen, dass durch die Gewohnheiten der Bankkunden im Umgang mit ihren Sichteinlagen in der Regel ein gewisser Sockel der Guthaben im Besitz des Kreditinstituts verbleibt. So gleichen sich z.B. Auszahlungen durch Einzahlungen anderer Kunden aus (Kompensation), oder Kunden verfügen zumindest nicht komplett über fällige Gelder, d.h. sie werden implizit verlängert (Prolongation).[19] Im Rahmen dieses Bodensatzes kann die Bank also eine Fristentransformation durchführen, d.h. diese formal täglich fälligen Gelder können langfristiger angelegt werden, beispielsweise in Form von Kreditvergaben. Das Kreditinstitut kann diesen Bodensatz also ertragreicher anlegen und so die Rentabilität steigern. Die sonstigen Einlagen sollten immer durch Barvermögen bzw. täglich fällige Aktiva gedeckt sein, da diese stets verfügbar sein müssen.
Als problematisch stellt sich jedoch die Ermittlung dieses Bodensatzes dar, welcher als Prozentsatz des aktuellen Einlagenvolumens angenommen wird.[20] Schwankungen des ermittelten und somit zur längerfristigen Anlage verwendeten Bodensatzes stellen wiederum ein Risiko dar. Hinzu kommt auch hier das Abrufrisiko. Insbesondere im Krisenfall kann sich das Verhalten der Einleger stark verändern, sodass auch der sonst üblicherweise bestehende Bodensatz plötzlich abgezogen wird und das Kreditinstitut in Liquiditätsprobleme gerät („Bank Run“). Die Theorie lässt zudem weitere Möglichkeiten der Generierung von Liquidität sowie die Bedeutung des Eigenkapitals außer Acht.[21] Der Grundgedanke der Bodensatztheorie hat dennoch große praktische Bedeutung. Das Prinzip findet seinen Niederschlag noch heute in der Liquiditätsverordnung (LiqV).
Die Shiftability Theorie (oder Realisationstheorie) stellt wiederum eine Erweiterung der Bodensatztheorie dar. Sie greift den Aspekt auf, dass Liquidität auch durch die kurzfristige Veräußerung von Aktiva generiert werden kann. Entwickelt wurde diese Theorie im Jahr 1879 von K. Knies. Der Grad der Fristentransformation ist hierbei abhängig vom Wert und der Liquidierbarkeit der Aktiva. Wichtige Faktoren hierfür sind zum einen das Vorhandensein eines aufnahmefähigen Marktes für die jeweilige Vermögensposition und zum anderen die eventuell vorhandenen Transaktionskosten bei der Veräußerung. Leicht liquidierbare Aktiva sind z.B. börsennotierte Wertpapiere. Sie sind börsentäglich veräußerbar und werden daher auch in der LiqV zum Teil als Zahlungsmittel angesehen.[22] Viele Aktiva können jedoch nur mit Abschlägen veräußert werden. Das hierbei bestehende Risiko über die Unsicherheit des Marktwertes bezeichnet man als Marktpreisrisiko.
Während die vorangehend dargestellten Theorien nach dem Going-Concern-Prinzip[23] von einem mehr oder weniger normalen fortlaufenden Geschäftsbetrieb ausgehen, konzentriert sich die im Jahr 1959 von W. Stützel entwickelte Maximalbelastungs-theorie auf den Extremfall eines „Bank Runs“.[24] Man bezeichnet diese Theorie daher auch als Insolvenztheorie.[25] Der Bodensatz tendiert in einem solchen Fall gegen Null. Stützel geht wie auch die Begründer der Shiftability Theorie davon aus, dass Aktiva kurzfristig veräußert werden können, um so benötigte liquide Mittel zu schaffen. Da er jedoch von einer maximalen Belastung der Liquidität ausgeht, ergänzt er die Theorie um die Überlegung, dass der Verkauf der Aktiva in einer solchen Situation nur noch mit erheblichen Abschlägen erfolgen kann. Diese so genannten Liquiditätsdisagios vermindern die Aktiva und werden dann den Einlagen gegenübergestellt. Stützel formulierte die Forderung der Maximalbelastungstheorie folgendermaßen: „Die Summe der Verluste, die bei einer derartigen vorzeitigen Abtretung gewisser Aktiva hin-genommen werden müssen, darf nie größer sein als das Eigenkapital.“[26] Wichtig ist bei diesem Ansatz also nicht die Übereinstimmung der verschiedenen Fristigkeiten auf der Aktiv- und Passivseite, sondern dass der Liquidationswert der Aktiva die Einlagen deckt. Die erwarteten Abschläge müssen dabei durch Eigenkapital gedeckt werden. Eine Fristentransformation ist auch hier also möglich, solange für etwaige Verluste Eigenmittel vorgehalten werden. Dennoch kann es auch hier zu Liquiditätsproblemen kommen, wenn es z.B. zu einem unerwartet starken Verfall der Marktpreise kommt.
2.3 Die betriebswirtschaftlichen Anforderungen
Als traditionelle Oberziele eines Kreditinstituts gelten Rentabilität, Liquidität und Sicherheit (auch „Magisches Dreieck“).[27] Ausreichende Liquidität ist wie bereits in Abschnitt 2.1 erläutert eine Notwendigkeit zur Sicherung der Unternehmensexistenz und stellt somit eine unabdingbare Bedingung für das Ziel der Sicherheit dar. Auf der anderen Seite gilt die Gewinnmaximierung in der Regel als Zweck wirtschaftlichen Handelns. Dies steht jedoch in einem Zielkonflikt mit der Liquidität, denn je mehr Mittel ein Unternehmen als Liquiditätsreserve bereithalten muss, desto geringer ist dessen Rentabilität (vgl. Abbildung 3). Es gilt der Grundsatz „Liquidität kostet Geld – Illiquidität die Existenz“.[28] Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es also die Aufgabe des Liquiditätsmanagements gleichzeitig den Ertrag zu optimieren sowie die jederzeitige Zahlungsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Bei der Frage nach der optimalen Liquidität handelt es sich demnach um ein Gleichgewichtsproblem.[29]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Schematischer Zielkonflikt zwischen Gewinn und Liquidität
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Chmielewicz, K. (1988), S. 40.
Würde man der Annahme von Stützel im Rahmen seiner Maximalbelastungstheorie („Die Liquidität folgt der Solvenz“ [30] ) folgen, so wäre dieses Optimierungsproblem gar nicht gegeben. Nach diesem Ansatz stellt es für ein solventes Unternehmen kein Problem dar, sich jederzeit Liquidität am Interbankenmarkt oder bei der Zentralbank zu beschaffen. In der Praxis erweist es sich jedoch als schwierig eine einwandfreie Bonität stets nach außen hin zu signalisieren. Hierbei geht es insbesondere um das Vertrauen der Einleger, das selbst durch Gerüchte stark negativ beeinflusst werden kann. Auch darf nicht davon ausgegangen werden, dass es sich beim Interbankenmarkt um eine nie versiegende Liquiditätsquelle handelt, denn dieser kam im Laufe der Subprime-Krise durch das enorme Misstrauen der Banken untereinander zeitweilig zum vollstän-digen Erliegen. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage von Bedeutung, zu welchem Preis die Liquidität zur Verfügung steht. Dieser Aspekt wird in Kapitel 4.2 noch näher betrachtet.
2.4 Die aufsichtsrechtliche Anforderungen
Wie bereits dargestellt besitzen Kreditinstitute eine gewisse Sonderstellung in der Volkswirtschaft. Das Vertrauen der Kunden spielt hierbei eine besondere Rolle. Es ist daher wichtig, dass die Solvenz der Banken nach außen hin gesichert scheint. Die Bankenaufsicht trägt ihren Teil hierzu bei, indem sie mit Rechtsnormen z.B. die Risikoübernahme der Banken limitiert. Hierzu bestehen quantitative und qualitative Regelungen. Erstere beinhalten die Einhaltung bestimmter Kennziffern, die auf internen oder externen Daten basieren. Qualitative Regelungen hingegen enthalten Vorgaben über die Qualität von Strukturen und Prozessen im Unternehmen.[31] Der Trend geht mittlerweile hin zu einer stärker qualitativen Regulierung. Die Verflechtungen der Banken untereinander können zudem zu Ansteckungseffekten führen, sodass das gesamte Bankensystem destabilisiert wird. Da ein funktionsfähiges Bankensystem jedoch einen wichtigen Teil zum gesamtwirtschaftlichen Wohlstand beiträgt, ist eine staatliche Aufsicht und Regulierung in diesem Bereich unerlässlich. Zu den wichtigsten Zielen der Bankenaufsicht zählen der Gläubiger- sowie der Systemschutz. Der Gläubigerschutz soll für die „Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte“[32] sorgen. Er dient als Mittel zum Zweck für den Systemschutz, welcher das Vertrauen gegenüber den Banken stärken und dadurch die Stabilität des Bankensektors gewährleisten soll.[33]
Das zentrale Organ der Bankenaufsicht in Deutschland stellt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz in Bonn dar. Diese übt ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank aus. Die Bundesbank übernimmt bei dieser Aufgabenteilung insbesondere die laufende Überwachung der Kreditinstitute sowie die Auswertung der von den Instituten regelmäßig einzureichenden Berichte. Des Weiteren prüft sie, ob deren Eigenkapitalausstattung und Risikosteuerungs-verfahren angemessen sind.[34] Die BaFin beaufsichtigt als deutsche Allfinanzaufsicht neben Banken auch sonstige Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapier-handel mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit und Stabilität des deutschen Finanzmarktes zu sichern. Im Rahmen der Bankenaufsicht überprüft sie, ob es sich bei den Instituten um zugelassene Unternehmen mit fachlich geeigneten und zuverlässigen Vorständen handelt. Außerdem überwacht sie die Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrecht-lichen Regulierungen. Die BaFin ist in diesem Zusammenhang jedoch grundsätzlich nicht dafür verantwortlich Insolvenzen von Banken zu verhindern. Für diesen Fall gibt es Einrichtungen zur Einlagensicherung, die den Gläubigerschutz gewährleisten. Sie hat jedoch Eingriffsmöglichkeiten, wenn die Schieflage eines Kreditinstitutes die Stabilität des gesamten Finanzsystems zu gefährden droht.[35]
Grundlage sämtlicher Normen im Bankensektor ist auf deutscher Ebene das Kreditwesengesetz (KWG). Als Orientierungshilfe für die jeweiligen nationalen Vor-schriften dienen regelmäßig die Empfehlungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht. Dieser setzt sich zusammen aus Vertretern der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden von mittlerweile 27 Ländern. Seinen Sitz hat er bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.[36]
2.4.1 Die Liquiditätsverordnung (LiqV)
Da das KWG lediglich einen gesetzlichen Rahmen bildet, werden dessen Anfor-derungen durch Verordnungen näher ausgelegt bzw. konkretisiert. So verlangt § 11 Abs. 1 S. 1 KWG von den Kreditinstituten ihre Mittel so anzulegen, dass eine ausrei-chende Zahlungsbereitschaft, d.h. Liquidität jederzeit gewährleistet ist. Was genau jedoch hierunter zu verstehen ist, wird in der Verordnung über die Liquidität der Institute (Liquiditätsverordnung, LiqV) näher festgelegt. Diese trat am 1. Januar 2007 in Kraft und hat den bis dahin geltenden Grundsatz II ersetzt. Neu war insbesondere die so genannte „Öffnungsklausel“ des § 10 LiqV, welche erstmalig unter bestimmten Voraussetzungen auch die bankaufsichtliche Nutzung von internen Modellen zur Liquiditätsrisikomessung und -steuerung ermöglichte.[37] Die LiqV enthält in erster Linie quantitative Regelungen zum Liquiditätsrisiko, d.h. es werden Vorgaben an die Menge und die Zusammensetzung der Liquidität der Kreditinstitute gestellt. Der Nachweis ausreichender Liquidität in diesem Sinne kann durch die Ermittlung der Liquiditäts-kennzahl nach dem Standardansatz oder durch den Einsatz interner Modelle erfolgen,[38] sofern die Voraussetzungen des § 10 Abs. 3 LiqV gegeben sind. Hiernach muss das interne Verfahren eine adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos gewährleisten sowie die Liquiditätslage eingehender und angemes-sener darstellen als der Standardansatz.[39] Zur Ermittlung der Kennzahlen im Rahmen des Standardansatzes der LiqV werden je nach Laufzeit verschiedene Laufzeitbänder betrachtet (vgl. Abbildung 4). Die LiqV definiert außerdem, was genau unter Zahlungsmitteln und Zahlungsverpflichtungen zu verstehen ist bzw. was als solche angerechnet werden darf.[40]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Die Einteilung der Laufzeitbänder
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an u.a. Abicht, R. (2010), Kapitel 4.3 S. 3.
Der Fokus der LiqV liegt grundlegend auf der kurzfristigen Liquidität, also auf einem Zeithorizont von einem Monat. Hierzu wird die Liquiditätskennzahl bestimmt, welche das Verhältnis von Zahlungsmitteln zu Zahlungsverpflichtungen angibt. Die Kennzahl ist monatlich im Voraus an die Deutsche Bundesbank zu melden.[41] Nach § 2 Abs. 2 LiqV gilt die Liquidität eines Kreditinstitutes demnach als ausreichend, wenn die zu ermittelnde Liquiditätskennzahl den Wert eins nicht unterschreitet, d.h. die vorhan-denen und innerhalb des nächsten Monats fälligen Zahlungsmittel die in diesem Zeitraum fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen decken (vgl. Abbildung 4)[42] Der Beschränkung auf einen Zeithorizont von einem Monat (Laufzeitband 1) liegt die Überlegung zugrunde, dass sich ein solventes und ertragsstarkes Kreditinstitut mittel- bis langfristig durch Kapitalaufnahme bzw. Veräußerung von Vermögen immer Liquidität beschaffen kann.[43] Problematisch ist demnach nur die kurzfristige Versor-gung mit Liquidität, da die Gefahr von Liquiditätsengpässen durch unerwartete Ereignisse oder besondere Marktgegebenheiten hier größer ist.
Auch der darüber hinaus liegende Zeitraum über einem Monat bis zu einem Jahr unterliegt jedoch der Beobachtung durch die Bankaufsicht. Hierzu sind die so genannten Beobachtungskennzahlen zu ermitteln.[44] Diese geben Hinweise auf die zukünftige Liquiditätssituation in den jeweiligen Zeiträumen des zweiten bis vierten Laufzeitbandes. Die Berechnung erfolgt analog der Liquiditätskennzahl, mit dem Unterschied, dass Liquiditätsüberschüsse in einem Laufzeitband dem nachfolgenden Laufzeitband angerechnet werden können.[45] Die erfolgende Gegenüberstellung von Zahlungsmitteln und Zahlungsverpflichtungen entsprechend ihren Restlaufzeiten wird auch als Maturity-Mismatch-Approach bezeichnet.[46] Im Gegensatz zur Liquiditäts-kennzahl gibt es bei diesen Kennzahlen keine Mindestanforderung an deren Höhe. Die Beobachtungskennzahlen haben lediglich informativen Charakter.[47]
An den momentan geltenden Regelungen zur Liquiditätsausstattung der Kreditinstitute gibt es jedoch eine Reihe von Kritikpunkten. So werden zur Berechnung der Liquiditätskennzahl künftige Ein- und Auszahlungen geschätzt, womit natürlich eine große Unsicherheit verbunden ist. Zudem werden nicht alle zu erwartenden Zahlungs-ströme berücksichtigt.[48] Des Weiteren handelt es sich um ein statisches Konzept, da nur Bilanzpositionen betrachtet werden. Dadurch werden mögliche zukünftige Zahlungszu- bzw. -abflüsse aus außerbilanziellen Geschäften, wie Swaps, Futures, Optionen und Kreditderivaten komplett außer Acht gelassen, obwohl diese in der Praxis oft einen Großteil der Bilanzsumme ausmachen. Zudem bringt der Fokus auf einen Zeitraum von einem Monat Nachteile mit sich. Durch diese Festlegung bleibt z.B. die sehr kurzfristige Liquiditätssituation (Tageshorizonte) unberücksichtigt.[49]
[...]
[1] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 2 ff.
[2] Vgl. Ludwig, B. (2010), S. 347.
[3] Vgl. Schierenbeck, H. / Lister, M. / Kirmße, S. (2008), S. 512.
[4] Vgl. Büschgen, H. E. (1998), S. 895 f.
[5] Vgl. Pohl, M. (2008), S. 10.
[6] Auch Refinanzierungs- oder Substitutionsrisiko.
[7] Vgl. Ludwig, B. (2010), S. 347.
[8] Vgl. Deutsche Bundesbank (2008), S. 60.
[9] Vgl. Biro, J. / Krapf, W. / Mayländer, R. (2009), S. 438.
[10] Vgl. Büschgen, H. E. (1998), S. 897 f.
[11] Zur Erklärung für die Existenz von Banken siehe Modell von Diamond (1984): „Financial Intermediation and Delegated Monitoring“.
[12] Vgl. Pohl, M. (2008), S. 30 f.
[13] Vgl. Deutsche Bank (o.J.).
[14] Vgl. Hübner, O. (1854), S. 28.
[15] Vgl. Pohl, M. (2008), S. 41.
[16] Vgl. Moch, N. (2007), S. 54 Tabelle 6.
[17] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 469.
[18] Vgl. Wagner, A. (1857), S. 162 ff.
[19] Vgl. Biro, J. / Krapf, W. / Mayländer, R. (2009), S. 209.
[20] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 470.
[21] Vgl. Eilenberger, G. (2011), S. 165.
[22] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 470 f.
[23] Auch Fortführungsprinzip oder Grundsatz der Unternehmensfortführung.
[24] Vgl. Pohl, M. (2008), S. 45.
[25] Vgl. Betge, P. (1996), S. 226.
[26] Vgl. Stützel, W. (1959) S. 42 ff. zit. nach Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 473.
[27] Vgl. Biro, J. / Krapf, W. / Mayländer, R. (2009), S. 437.
[28] Vgl. u.a. Böhm, R. / Müller, C. / Siegenthaler, C. (2001), S. 223.
[29] Vgl. Moch, N. (2007), S. 39 ff.
[30] Vgl. Ketzel, E. / Prigge, S. / Schmidt, H. (2001), S. 22.
[31] Vgl. Moch, N. (2007), S. 20 f.
[32] Vgl. § 6 Abs. 2 KWG.
[33] Vgl. Stober, R. (2007), S. 542.
[34] Vgl. § 7 Abs. 1 KWG.
[35] Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2012a), S. 2.
[36] Vgl. o.V. (2012): Baseler Ausschuss.
[37] Vgl. Deutsche Bundesbank (o.J./a).
[38] Vgl. u.a. Abicht, R. (2010), Kapitel 4.3 S. 2.
[39] Vgl. u.a. Abicht, R. (2010), Kapitel 4.3 S. 7 bzw. § 10 Abs. 3 LiqV.
[40] Vgl. §§ 3 und 4 LiqV.
[41] Vgl. Moch, N., S. 25.
[42] Vgl. § 2 Abs. 1 S. 2 LiqV.
[43] Vgl. u.a. Abicht, R. (2010), Kapitel 4.3 S. 2.
[44] Vgl. § 2 Abs. 2 LiqV.
[45] Für ein Berechnungsbeispiel siehe Anhang 1.
[46] Vgl. Eilenberger, G. (2012), S. 83.
[47] Vgl. Pohl, M. (2008), S. 61.
[48] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Hellwig, M. / Jäger-Ambrozewicz, M. (2010), S. 20.
[49] Vgl. Hartmann-Wendels, T. / Pfingsten, A. / Weber, M. (2010), S. 492 f.
Details
- Titel
- Liquiditätsmanagement: Neue Anforderungen an die Kreditinstitute
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V296885
- ISBN (Buch)
- 9783863414870
- ISBN (PDF)
- 9783863419875
- Dateigröße
- 468 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Basel III MaRisk LCR NSFR Finanzkrise Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2012, Liquiditätsmanagement: Neue Anforderungen an die Kreditinstitute, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/296885
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.