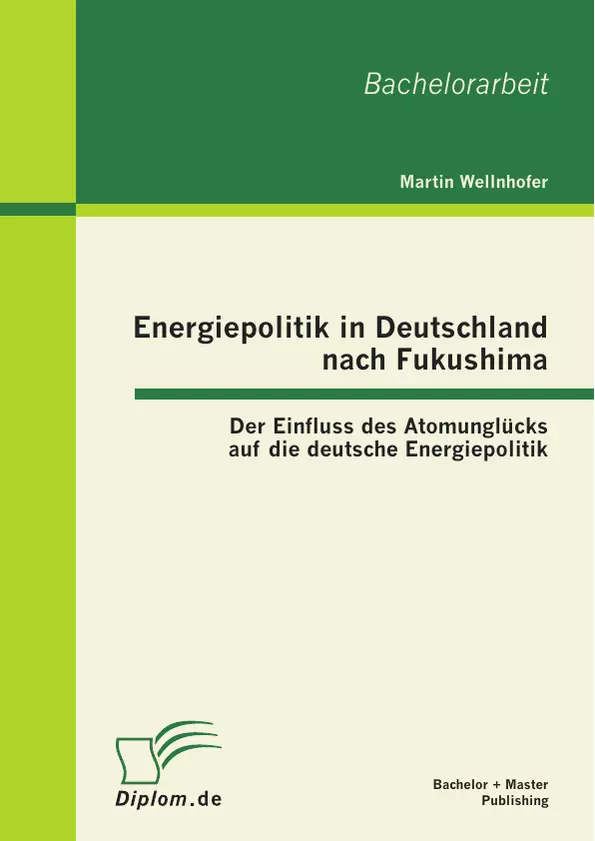Veröffentliche auch du deine Arbeit – es ist ganz einfach!
Mehr Infos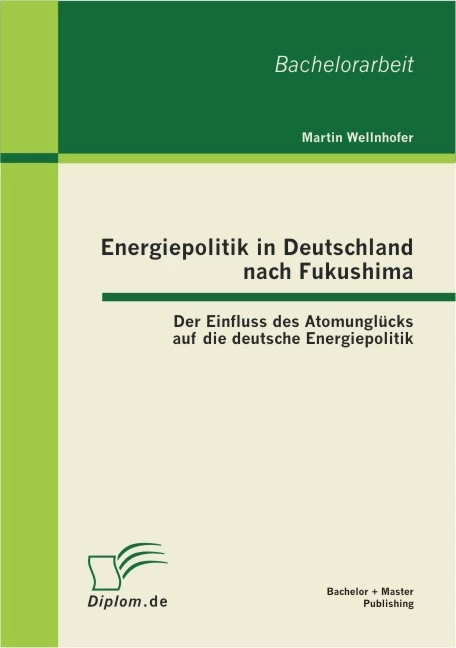
Energiepolitik in Deutschland nach Fukushima: Der Einfluss des Atomunglücks auf die deutsche Energiepolitik
Bachelorarbeit, 2011, 49 Seiten
Autor

Kategorie
Bachelorarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
1 Einleitung
Am 11. März 2011 ereignete sich in Japan eine Naturkatastrophe, die eine weltweite Debatte über die nukleare Energiegewinnung auslöste und die Sicherheit von Kernkraftwerken, nach dem Atomunfall von Tschernobyl 1986, erneut in Frage stellt. Ein Tsunami, der durch ein starkes Erdbeben vor der nordöstlichen Pazifik-Küste ausgelöst wurde, zerstörte weite Teile der Region an der nördlichen Ostküste Japans, forderte zehntausende Menschenleben und führte letztlich, nach einer Aufeinanderfolge unglücklicher Ereignisse, zu einem Reaktorunfall im Kernkraftwerk von Fukushima. Das zerstörerische Ausmaß der Katastrophe und die nicht abzuschätzenden Folgen des Nuklearunfalls lösten in vielen Nationen eine Debatte über die Frage nach der Sicherheit von Atomkraftwerken vor vergleichbaren Naturkatastrophen und anderen Gefahrenquellen aus.
Den Atomkraftwerksbetreibern der Europäischen Union oblag es nun in Eigen-verantwortung, ihre Kraftwerke einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Insbesondere die deutsche Bundesregierung reagierte schon kurz nach dem Ereignis in Japan mit einer Maßnahme, die sich deutlich von den Entscheidungen anderer europäischer Länder unterschied. Bereits drei Tage nach dem Reaktorunglück, am 14. März 2011, verkündete die Bundeskanzlerin Angela Merkel alle 17 in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke auf ihre Sicherheit überprüfen zu lassen und die sieben ältesten Atommeiler mit sofortiger Wirkung vom Stromnetz zu nehmen.
Dieses sogenannte Atom-Moratorium, welches laut dem 2010 verabschiedeten Atomgesetz im Falle einer Gefahrenabwehr eingesetzt werden kann, war so lang gültig, bis eine Einigung über die weitere Vorgehensweise der zukünftigen Energieerzeugung gefunden wurde. Eine eigens dafür einberufene Ethik-Kommission sollte innerhalb von drei Monaten darüber entscheiden, ob die sieben abgeschalteten Atomkraftwerke vom Netz bleiben und wie, daraus folgend, ein sicherer Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien ermöglicht werden kann. Der Schwerpunkt lag dabei auf einer Bewertung der Sicherheit von Atomkraftwerken, die in einer Energiedebatte unter anderem mit Akteuren aus Wirtschaft und Umwelt diskutiert wurde. Als Grundlage für die Diskussion diente eine technische Überprüfung der Atommeiler, die von der Reaktorsicherheitskommission während der Zeit des Moratoriums durchgeführt wurde. Schon vor der eigentlichen Entscheidung über die zukünftige Energieversorgung zeichnete sich ein Trend ab, der einen schnelleren Ausstieg aus der Atomstrom-produktion immer wahrscheinlicher werden ließ. Bereits vor dem Ende des Atom-Moratoriums verkündete die Bundesregierung, dass der Atomausstieg bis 2022 erfolgen soll. Daraus folgte, dass alle Atomkraftwerke, die nach dem Atomunfall in Fukushima abgeschaltet wurden, zukünftig nicht mehr für die Energiebereitstellung eingesetzt werden.
Mit dieser Entscheidung schlägt die Bundesregierung einen neuen Weg in ihrer Energiepolitik ein und revidiert das im Oktober 2010 beschlossene Energiekonzept, welches schon damals, nicht nur seitens der oppositionellen Parteien SPD und Grüne, sondern auch von der gesellschaftlichen Mehrheit, auf heftige Kritik und Gegenwehr stieß. Um eine bezahlbare, umweltschonende und wirtschaftliche Energieversorgung bereitzustellen, war in diesem Energiekonzept eine Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke von acht bis 14 Jahren vorgesehen (BMWi & BMU 2010:15). Dieser sowie neun weitere Eckpunkte des Energiekonzepts wurden am 28. Oktober 2010 zur Gesetzesgrundlage der deutschen Energiepolitik.
Während die Union den Gesetzesentwurf als „Meilenstein der Energiepolitik“ (Deutscher Bundestag 2010:o.S.) bezeichnete, unterstellten die Parteien SPD, Linke und Grüne, dass die Entscheidung einer Laufzeitverlängerung in erster Linie unter dem Einfluss der führenden Energiekonzerne getroffen wurde (Deutscher Bundestag 2010:o.S.). Auch in der Gesellschaft fand der Beschluss des neuen Atomgesetzes keine mehrheitliche Akzeptanz und führte vor allem in Berlin zu Massendemonstrationen (o. Verf. 2009b:o.S.). Die Proteste und Demonstrationen, ob von der Opposition oder seitens der Gesellschaft, zeigten eines ganz deutlich: In Deutschland herrschte nach dem Bundestagsbeschluss im Oktober 2010 kein einheitlicher Konsens über die Entscheidung einer Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Die energiepolitische Kehrtwende der Bundesregierung erschwerte daraufhin Investitionsplanungen, der mit erneuerbaren Energien arbeitenden Stromkonzerne, was nicht zuletzt die Wettbewerbs-fähigkeit dieser Unternehmen gefährdete.
Nach dem Vorfall in Fukushima schlägt die Bundesregierung nun erneut einen Kurswechsel ein und verkürzt wiederum die Laufzeiten der Atomkraftwerke, die nicht unmittelbar nach der Atomkatastrophe vom Netz genommen wurden. Die deutsche Energiepolitik findet somit wieder einen Anschluss an die energiepolitischen Vorgaben der rot-grünen Bundesregierung, welche bereits 2002 einen derartigen Atomausstieg in Vereinbarung mit den Energiekonzernen beschlossen hatte.
Wie im geschichtlichen Abriss der Energiepolitik bereits angedeutet wird, zeigt sich in der deutschen Energiepolitik seit mehr als zehn Jahren ein stetiger Wandel, der immer wieder eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Notwendigkeit der atomaren Energiegewinnung zur Folge hat. Die Planungsvorgaben zum Ausstieg aus der Atomenergie konnten von der rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005 und unter der Regierung der großen Koalition bis 2009 zum Großteil umgesetzt werden. Ein erster politischer Diskurs bahnte sich jedoch mit dem Regierungswechsel 2009 an, als die koalierenden Parteien CDU/CSU und FDP eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke beschlossen. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011, wurde in Deutschland eine erneute Debatte über die zukünftige Energieversorgung ausgelöst, die sich nicht nur mit der Frage einer Laufzeit-verlängerung von Atomkraftwerken auseinandersetzt. Die in den Medien verbreitete Energiedebatte beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie ein frühzeitiger Ausstieg aus der Atomenergie durch die zusätzliche Nutzung fossiler Energieträger, wie Stein- und Braunkohle, kompensiert werden kann, ohne dabei die vorgegebenen Klimaschutzziele und den Ausbau erneuerbarer Energien zu vernachlässigen.
Ziel und Inhalt der vorliegenden Bachelorarbeit ist eine Analyse der medialen Berichterstattung der Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Dabei wird untersucht, durch welche Ereignisse und Akteure die im März 2011 ausgelöste Energiedebatte in Deutschland zustande gekommen ist und welche Hintergründe zum aktuellen energiepolitischen Diskurs geführt haben. Um die politischen Entscheidungen nachvollziehen zu können, wird ein holistischer Ansatz hergestellt, der die energiepolitischen Diskurse seit den Anfängen des geplanten Atom-ausstiegs im Jahr 1998 beschreibt und damit Voraussetzung für eine vergleichende Analyse dieser Diskurse ist.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst die Diskursanalyse, als angewandtes qualitatives Analyseverfahren für die Bearbeitung der Medienberichte, sowohl in der Theorie als auch in der Methodik näher erläutert. Die im zweiten Abschnitt beschriebenen Eckpunkte der Atomkonsensvereinbarung von 2000 dienen als Grund-lage für die darauffolgenden beiden Abschnitte, in denen zum einen die Hintergründe der 2010 beschlossenen Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke und zum anderen die erneute Kehrtwende in der Energiepolitik, hin zu einem schnelleren Ausstieg aus der Kernenergie, diskursanalytisch untersucht werden. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Diskursanalyse sowie deren Bezug zur Ausgangslage der deutschen Atomausstiegspolitik zusammengefasst.
2 Theoretische Grundlagen und methodische Überlegungen
In diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit soll zunächst die methodische Vorgehensweise, die zur Analyse der Forschungsschwerpunkte angewandt wurde, sowie deren theoretischer Hintergrund näher erläutert werden. Um die historische und gegenwärtige Entwicklung der deutschen Energiepolitik zu untersuchen, bietet sich das Verfahren der Diskursanalyse an. Wie bereits in der Einleitung angesprochen, bezieht sich dieses Analyseverfahren vorrangig auf die Auswertung von Medienberichten, die in Form von Zeitungsartikeln in überregionalen deutschen Tageszeitungen ver-öffentlicht wurden. Hierzu zählen ebenfalls textförmige und audiovisuelle Daten, die auf den jeweiligen Internetseiten der Zeitungen auffindbar sind.
2.1 Die Diskurstheorie
Ein Diskurs bezeichnet im Allgemeinen die in einer aktuellen Debatte geführten öffentlichen Diskussionen, Positionen und Äußerungen von Politikern und anderen beteiligten Akteuren (Keller 2011:13). Diskurse sind die Folge von Ereignissen, die sich in der realen Welt zugetragen haben. Dies können beispielsweise politische Wahl-entscheidungen, Terroranschläge oder, wie in der zu untersuchenden Fragestellung, der Reaktorunfall in Fukushima sein (Jäger 2004:132). Vergangene Diskurse können dabei so problematisiert werden, dass sich ein sogenannter Gegen-Diskurs entwickelt, der sich gegen einen vorherrschenden Diskurs wendet. Ein Diskurs ist demnach nur ein Teil einer zeitlich begrenzten Abfolge von hegemonialem Wissen, das teilweise sozial verfestigt ist (Jäger 2004:129).
Um einen Diskursstrang „historisch und gegenwartsbezogen zu analysieren und zu kritisieren“ (Jäger 2004:188), wird das Verfahren der Diskursanalyse angewendet. Die Aufgabe dieses Analyseverfahrens ist es nun, das zeitlich begrenzte Wissen bzw. den vorherrschenden Diskurs kritisch zu hinterfragen, Bedeutungsinhalte aufzudecken und eventuell auf die Entstehung von Gegen-Diskursen sowie deren Ursachen und Hintergründe einzugehen.
2.2 Das Verfahren der Diskursanalyse
Die Diskursanalyse ist ein größtenteils qualitatives Analyseverfahren, das Handlungen und Machtwirkungen, die aufgrund von sprachlichen Wirkungsmitteln zustande gekommen sind, analysiert und deren Auswirkungen auf den Gesamtkontext des Diskurses untersucht (Jäger 2004:127). Die Machtwirkungen der am Diskurs beteiligten Akteure werden mithilfe verschiedener Redeweisen und Konzepte ausgeübt und können somit einen entscheidenden Einfluss auf die sozio-historische Entwicklung der Gesellschaft haben.
Im Allgemeinen sieht die Methodik einer Diskursanalyse vor, Texte in ihre elementaren Diskursfragmente zu untergliedern. Diese Textbestandteile, welche sich jeweils auf ein bestimmtes Themengebiet des Diskurses beziehen, ergeben in ihrer Gesamtheit einen Diskursstrang, der einen „thematisch einheitliche[n] Wissens[fluss] durch die Zeit“ (Jäger 2004:160) widerspiegelt. Damit ist gemeint, dass ein Diskursstrang im Laufe der Zeit durch die mediale Verbreitung seiner diskursiven Ereignisse gekennzeichnet und durch diese zugleich beeinflussbar ist. Findet ein reales Ereignis kein medienwirksames Interesse, so hat dies auch keinen Einfluss auf den Verlauf und die Entwicklung des hegemonialen Diskurses. Wird ein reales Ereignis andererseits, wie im Fall des Reaktorunfalls in Fukushima, zu einem medialen Großereignis, so kann es einen beachtlichen Einfluss auf die politischen Entscheidungen eines Landes haben. Die Diskursanalyse trägt im Wesentlichen dazu bei, zu ermitteln, ob Ereignisse dieser Art zu diskursiven Ereignissen werden und welche Auswirkungen sie auf aktuelle hegemoniale Diskurse haben (Jäger 2004:162).
2.3 Die qualitative Inhaltsanalyse als vorverarbeitender Schritt der Feinanalyse
Für die Bearbeitung der zu untersuchenden Fragestellung bietet es sich an, für eine vorverarbeitende Strukturanalyse, auf das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zurückzugreifen. Diese Methode analysiert nicht, wie die quantitative Inhaltsanalyse, die Anzahl bestimmter Textelemente, sondern legt mehr Wert auf die inhaltlichen Aussagen von Textbestandteilen, die in Bezug zur übergeordneten Fragestellung der Diskursanalyse eine kontextuelle Verbindung ermöglichen.
Der Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Erarbeitung eines Kategorien-systems, welches vor der Bearbeitung des Textmaterials die wichtigsten thematischen Aspekte festlegt, um somit eine Voraussetzung für die vergleichende Analyse von unterschiedlichen Kategorien herzustellen (Mayring 1999:91).
Laut Mayring findet die qualitative Inhaltsanalyse heute in nahezu allen Wissen-schaftsbereichen Anwendung und kann folgend auch für die Untersuchung naturwissenschaftlicher, speziell in diesem Fall humangeographischer, Themengebiete in Betracht gezogen werden. Der Sinngehalt dieses methodischen Verfahrens liegt insbesondere darin begründet, eine systematische Technik für die Analyse von Texten zu verwenden, die einer quantitativen Auswertung von sprachlichem Material zuvorkommt (Mayring 2000:469). Eben dieses sprachliche Material, welches in Form von medialen Textfragmenten vorliegt, ist die grundlegende Voraussetzung für die inhaltliche Analyse der in den Fragmenten getroffenen Aussagen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring 1999:93)
Weiter beschreibt Mayring in seinen Ausführungen drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Zusammenfassung, als eine der drei Grundformen, bezeichnet dabei eine induktive Kategorienbildung, die als ein Teil des Analyseverfahrens angewendet wird, um das Textmaterial nach seiner Relevanz im Hinblick auf den Gesamtkontext bzw. den Gegenstand der Analyse zu gewichten. Die Kategoriendefinitionen werden, wie in Abbildung 1 dargestellt, durch einen zeilenweisen Materialdurchgang festgelegt. Eine Kategorie wird also definiert, wenn ein Satz oder ein Begriff „nahe am Material formuliert“ (Mayring 1999:92) und im weiteren Verlauf eines Textes wiederzufinden ist. Nachdem alle Kategorien gebildet wurden, werden sie nach ihrer Logik in Bezug auf die vorhandene Thematik überprüft und, falls notwendig, nochmals korrigiert (Mayring 1999:93).
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring stellt einen übergeordneten Begriff für verschiedene Analyseverfahren qualitativer Forschungsmethoden dar. Wie auch Reuber & Pfaffenbach beschreiben, „greift die Analyse von Diskursfragmenten sehr stark auf Strategien, Formen und Perspektiven der klassisch-interpretativen Textanalyse zurück“ (Reuber & Pfaffenbach 2005:214) und wird somit als ein vorverarbeitender Schritt in die Diskursanalyse einbezogen. Für die hier vorliegende Problematik, welche eine Veränderung bzw. Neuausrichtung der Energiepolitik beschreibt, wird die qualitative Inhaltsanalyse als grundlegendes Verfahren für die Feinanalyse von Diskursfragmenten angewandt, um die Inhalte der Texte nachfolgend „als Bestandteil eines gesellschaftlichen und historisch verankerten Gesamtdiskurses“ (Jäger 2004:119) zu verstehen.
2.4 Konkrete methodische Vorgehensweise
Um die Diskurse der Energiepolitik zu analysieren, wurde das diskursanalytische Verfahren in leicht abgewandelter Form individuell auf die zu untersuchende Fragestellung zugeschnitten. Dies resultiert aus der Tatsache, dass Jäger sein methodisches Vorgehen lediglich als eine Richtlinie, und weniger als strenge Vorgabe, für die Analyse von Textmaterial sieht (Jäger 2004:172). Für die Bearbeitung der Thematik wurde demnach ein Verfahren erstellt, das den Diskurs in erster Linie auf seine inhaltlichen Schwerpunkte untersucht, um diese hinsichtlich ihrer Relevanz in den Gesamtkontext der Energiedebatte einordnen zu können. Eine quantitative Daten-erfassung, wie beispielsweise die Auszählung aller Medienberichte, die nach einem diskursiven Ereignis erschienen sind, wird dabei ebenso wie die Untersuchung „spezifischer-rhetorischer Mittel“ (Keller 2011:70) nur bedingt in die Diskursanalyse einbezogen, da eine sprachwissenschaftliche Analyse der Texte eher von unter-geordneter Bedeutung ist. Vielmehr soll der Schwerpunkt der Analyse, wie oben erwähnt, auf den Inhalten getroffener Aussagen von Politikern und beteiligten Akteuren liegen, die in den Kontext des allgemeinen Diskursstrangs eingeordnet werden (Jäger 2004:71).
Das für die Diskursanalyse verwendete Datenmaterial umfasst, neben weiteren gesammelten Datenmaterialien, insgesamt 60 Zeitungsartikel der Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Für die Fein-analyse der energiepolitischen Diskurse von 2010 und 2011 wurden jeweils 30 Artikel nach spezifischen Kriterien ausgewählt. Hierbei sei angemerkt, dass die verwendeten Texte sowohl tägliche Meldungen und Berichte als auch Interviews umfassen. Neben den ausgewählten Diskursfragmenten wird der Datenkorpus zusätzlich durch weitere textförmige und audiovisuelle Medienformate ergänzt. Dies ist insbesondere notwendig, um die in der Feinanalyse untersuchten diskursiven Abläufe in den Gesamtkontext des Diskurses einordnen zu können.
Die Auswahl der Diskursfragmente erfolgte, wie oben angesprochen, nach spezifischen Auswahlkriterien. In der Vorbearbeitung des Datenmaterials wurde dazu eine Hierarchie erstellt, welche die wichtigsten Stichwörter zum Thema „Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik“ enthält (Jäger 2004:191). Die Wahl der Stichwörter erfolgte, nachdem ein Datenkorpus der wesentlichen Medien gesichtet und nach Themen und Unterthemen in ihrer qualitativen und quantitativen Bandbreite aufbereitet wurde (Jäger 2004:174). Alle Stichwörter wurden nachfolgend, wie in Abbildung 2 dargestellt, einer Hierarchie zugeordnet, welche die Themengebiete nach ihrer Relevanz für die diskursanalytische Untersuchung gliedert. Mit dieser getroffenen Auswahl konnte schon vor der Feinanalyse des Datenmaterials eine Einteilung der wichtigsten Begriffe, die sich in den Aussagen, der an der Energiedebatte beteiligten Politiker und Akteure wiederfinden, vorgenommen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Stichworthierarchie für die Artikelauswahl der Feinanalyse
(eigene Darstellung)
Mithilfe der Stichworthierarchie konnten nun für beide Energiedebatten jeweils 30 repräsentative Zeitungsartikel ausgesucht werden, in denen die festgelegten Stichworte thematisiert werden. Des Weiteren wurden die Diskursfragmente so gewählt, dass sie möglichst einen Zeitraum abdecken, der vom Beginn des Diskurses bis zum Dispositiv – der Etablierung des Diskurses in der „materiellen und ideellen Infrastruktur“ (Keller 2011:68) – reicht, um so die gesamte Bandbreite des Diskursstrangs qualitativ zu erfassen.
Die Untersuchung der archivierten Diskursfragmente orientiert sich in erster Linie an den von Jäger beschriebenen Analyseschritten. Für die Bearbeitung der zu untersuchenden Thematik wird das Verfahren jedoch in einer modifizierten Form angewendet. Die Analyse eines Diskursfragments bzw. Zeitungsartikels umfasst somit, wie in Tabelle 3 dargestellt, folgende fünf Analyseschritte:
Tabelle 1: Analyseverfahren für die Bearbeitung einzelner Diskursfragmente
(eigene Darstellung auf Grundlage von Jäger 2004:175ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach der Feinanalyse aller Diskursfragmente werden die analysierten Zeitungsartikel zusammengefasst und in ihrer Gesamtheit interpretiert. Für die Analyse des gesamten diskursiven Kontextes werden anschließend alle wesentlichen Ergebnisse zusätzlich gesammelter Daten hinzugefügt und gemeinsam mit den Ergebnissen der Feinanalyse interpretiert.
3 Die deutsche Energiepolitik von 1998 bis 2009
Dieses Kapitel der Arbeit bezieht sich auf die Anfänge der deutschen Atom-ausstiegspolitik, die erstmals seit 1998, nach dem Antritt der rot-grünen Bundes-regierung, ein Teil der deutschen Energiepolitik wurde. Der hegemoniale Diskurs dieser Legislaturperiode stellt den Ausgangspunkt für die Analyse aller darauffolgenden energiepolitischen Diskurse dar. Die Untergliederung des Diskursstrangs in seiner zeitlichen Abfolge soll es erlauben, gegenwärtige und zukünftige diskursive Abläufe in den Gesamtkontext des energiepolitischen Diskurses einzuordnen (Jäger 2004:169). Aus diesem Grund werden die folgenden Ausführungen detailliert beschrieben, um so gegebenenfalls auch diskursive Zusammenhänge zwischen gegenwärtigen und ver-gangenen Handlungen aufzeigen zu können.
3.1 Energiepolitische Ziele
Die energiepolitischen Ziele der rot-grünen Bundesregierung beziehen sich in erster Linie auf eine Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Um dieses Ziel zu erreichen und um die gesellschaftlichen Risiken der Kernenergie zu umgehen, sollte der Ausbau der Atomkraftwerke in Deutschland in Zukunft nicht mehr gefördert, sondern schnellstmöglich beendet werden. Die Kernpunkte der energiepolitischen Ziele um-fassen zum einen das Verbot des Neubaus von kommerziellen Atomkraftwerken und zum anderen eine Beschränkung des Betriebs von bestehenden Anlagen. Beide Schwer-punkte sowie weitere energiepolitische Vorgaben der Atomausstiegspolitik werden im Folgenden näher erläutert.
Durch die Beschränkung des Betriebs von atomaren Anlagen wird eine maximal zulässige Reststrommenge festgelegt, die bis zur endgültigen Stilllegung des Atomkraftwerks produziert werden darf. Nachdem die jeweils vorgesehene Rest-strommenge eines Kraftwerks erreicht worden ist, wird der Betrieb der Anlage eingestellt. Für eine flexible Nutzung der Energie können Reststrommengen „von weniger wirtschaftlichen auf wirtschaftlichere Anlagen“ (BMU 2000:5) oder mit anderen Worten, von älteren Atomkraftwerken auf jüngere Atomkraftwerke übertragen werden. Diese Form der Energieübertragung ist zwar gesetzlich erlaubt, bedarf jedoch der Zustimmung einer Arbeitsgruppe, „die sich aus drei Vertretern der beteiligten Unternehmen und drei Vertretern der Bundesregierung zusammensetzt“ (BMU 2000:12).
Die jährliche Reststrommenge von bestehenden Anlagen wird auf Grundlage ihrer Restlaufzeit bestimmt. Die noch verbleibende Restlaufzeit wird dabei für jedes Kraftwerk auf 32 Jahre seit seiner Inbetriebnahme befristet (BMU 2000:4). Ein weiterer Aspekt des geplanten Atomausstieges ist die Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheits-standards bei bestehenden Atomkraftwerken und sonstigen kerntechnischen Anlagen. Um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, unterliegen alle Anlagen der Pflicht einer Sicherheitsüberprüfung, die in einem Abstand von 10 Jahren wiederholt wird (BMU 2000:7).
Auch bei der Endlagerfrage werden die Sicherheitsanforderungen erhöht. Statt einem zentralen Entsorgungslager, in dem alle Endlagerprodukte der Kernkraftwerke gespeichert sind, sollen mehrere Zwischenlager in dezentraler Lage errichtet werden. Die Entsorgung radioaktiver Abfälle soll zukünftig „auf die direkte Endlagerung beschränkt“ (BMU 2000:8) werden, was zur Folge hat, dass Abfallmengen in un-mittelbarer Nähe zu den Atomkraftwerken gelagert werden. Da der Bau der Zwischen-lager eine Zeit von fünf Jahren in Anspruch nehmen sollte, war der Transport von Wiederaufbereitungsprodukten nur innerhalb dieses Zeitraums erlaubt. Ab dem 1. Juli 2005 sollte die Abgabe von Brennelementen an Wiederaufbereitungsanlagen verboten werden (BMU 2000:8).
Neben den angesprochenen Schwerpunkten der Atomausstiegspolitik, hatte die rot-grüne Bundesregierung den Anspruch eine umweltverträgliche und wettbewerbsfähige Energieversorgung bereitzustellen, um im Ergebnis eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im Energiedienstleistungsbereich sichern zu können (BMU 2000:12).
3.2 Planung und rechtliche Absicherung des Atomausstiegs
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Verant-wortbarkeit der Kernenergie wurde deren geordnete Beendigung in der Vereinbarung vom 14. Juni 2000 beschlossen. Zuvor hatten die regierenden Parteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Koalitionsvertrag 1998 den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie vereinbart. Diesbezüglich einigten sich die Bundesregierung und führende Energieversorgungsunternehmen am 14. Juni 2000 die oben genannten energiepolitischen Ziele umzusetzen. Die formulierten Kernpunkte der Vereinbarung traten ab 27. April 2002 mit dem Entwurf des Atomausstiegsgesetzes in Kraft. Der neue Gesetzesentwurf sollte eine Richtlinie für eine deutsche Energieversorgung sein, in der ein Ausbau erneuerbarer Energien durch die geordnete Beendigung der Kernenergie gefördert wird. Die Atomgesetznovelle, welche an Stelle des Atomförderungsgesetzes von 1959 trat, bezeichnete der damalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin als „die konsequente Antwort auf Tschernobyl“ (BMU 2002c:o.S.). Es sollte die Grundlage für eine zukunftsfähige Energiepolitik sein, in der die Forschung und Entwicklung sowie die Marktfähigkeit energieeffizienter Technologien vorangetrieben wird.
3.3 Nationale Klimaschutzziele
3.3.1 Allgemeine Zielsetzungen
Der Beschluss einer geordneten Beendigung der Kernenergie verlangte von der rot-grünen Bundesregierung eine Modifikation der Klimaschutzziele, in welcher die Emission klimaschädlicher Treibhausgase, trotz des Ausstiegs aus der CO2-emissionsarmen Kerntechnologie, kompensiert und rapide gemindert werden kann. Aufgrund dieser notwendigen Veränderung sowie der allgemeinen umweltpolitischen Herausforderung an den weltweiten Klimawandel beschloss die Bundesregierung am 18. Oktober 2000 das nationale Klimaschutzprogramm. Es sollte einer kontinuierlichen Fortentwicklung der Klimaschutzpolitik dienen und somit eine Richtlinie für eine nachhaltige Entwicklung einer umweltfreundlichen Energieversorgung sein (BMU 2000a:14). Mit dem nationalen Klimaschutzprogramm sollten die Kohlendioxid-emission bis 2005 gegenüber 1990 um 25 Prozent und die Emissionen der sechs Treibhausgase des Kyoto-Protokolls im Zeitraum 2008 bis 2012 um 21 Prozent (BMU 2000b:2) reduziert werden. Für das Erreichen der Ziele sollte sich der Anteil erneuerbarer Energien am Energieträgermix bis 2010 verdoppeln. Grundlegend dafür war ein Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und damit verbunden, eine Steigerung der Energieproduktivität.
Der beschlossene Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie stellte die nationale Klimaschutzpolitik jedoch vor eine neue Herausforderung: Die geordnete Beendigung der emissionsarmen Kernenergie, welche am 14. April 2000 mit der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Energieversorgungsunternehmen beschlossen wurde, musste durch alternative Energieträger mit einer möglichst geringen Treibhaus-gasemission kompensiert werden. Dieser Aspekt gab, neben den allgemein formulierten Klimaschutzzielen, einen Anlass zum Umdenken in der Nutzung vorhandener Energie-ressourcen. Die zukünftige Energieversorgung sollte sich demnach „am Leitbild der Nachhaltigkeit orientier[en] und den Kriterien Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“ (BMU 2000a:27) gerecht werden.
3.3.2 Konkrete Maßnahmen
In der Energiebereitstellung und Energienutzung sollten Einsparpotentiale durch einen sparsameren Energieeinsatz gewonnen werden. Die Kraft-Wärme-Kopplung trägt einen wesentlichen Anteil an der Erhöhung der Energieproduktivität. Durch ihren Ausbau sollte bis 2010 eine Minderung der Kohlendioxidemissionen von bis zu 23 Mio. Tonnen erreicht werden (BMU 2000a:28).
Um die Energieverluste des Ausstiegs aus der Kernenergie zu kompensieren, wurde der Ausbau fossiler und erneuerbarer Energieträger subventioniert. Da erneuerbare Energien aufgrund fehlender Speichertechnologien keine Grundlast tragen können, sollte diese zunächst durch fossile Energieträger übernommen werden. Investitionen in die Forschung und Entwicklung sollten jedoch in Zukunft den Anteil erneuerbarer Energie an der Grundlast und am Primärenergieverbrauch erhöhen. Der zukünftige Energiemix sollte demnach sowohl aus fossilen Energieträgern (Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle u.a.) als auch aus erneuerbaren Energieträgern (Windenergie, Bioenergie, Solarenergie, Wasserkraft u.a.) zusammengesetzt sein.
Die Steigerung der Energieeffizienz erforderte zudem eine Anpassung der Energie-nutzung in den Sektoren private Haushalte, Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft. Die nachfolgend beschriebenen Punkte sollen die wichtigsten sektoralen Energie-effizienzmaßnahmen benennen.
Im Sektor private Haushalte waren die größten CO2-Einsparpotentiale im Wohn- und Gebäudebereich zu erreichen. Die Kernpunkte zielten dabei auf eine Minderung des Gebäudebestandes sowie dessen Anpassung an bestehende klimaschutzpolitische Vorgaben (BMU 2000a:41). Dies betrifft insbesondere die Erneuerung von veralteten Heizungsanlagen sowie den Einbau von Wärmedämmungen (BMU 2000a:41f.). Im Ergebnis sollte eine Senkung des Energiebedarfs von Gebäuden um bis zu 30 Prozent erreicht werden. Mit der Erneuerung des Gebäudebestandes sollten nicht nur die CO2-Emissionswerte reduziert werden. Der Sanierungsbedarf von Wohngebäuden hatte vor allem positive Effekte auf die Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungs-plätzen (BMU 2000a:44).
Der Wirtschaftssektor hatte sich das Ziel gesetzt, seinen CO2-Verbrauch bis 2005 gegenüber 1990 um 20 Prozent zu mindern (BMU 2000a:53). Des Weiteren sollten die Emissionen der sechs Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll aufgeführt sind (CO2, CH4, N2O, SF6, HFKW und FKW), um 35 Prozent bis 2012 gegenüber 1990 gesenkt werden. Ein energieeffizienter Betrieb industrieller Anlagen sollte in erster Linie durch den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung – die gekoppelte Nutzung abgegebener Wärme zur Stromzeugung – erreicht werden. Um Anreize für den Ausbau der industriellen Kraft-Wärme-Kopplung zu schaffen, wurden von der Bundesregierung „Steuer-ermäßigungen und Steuerfreistellungen im Stromsteuer- und Mineralölgesetz“ (BMU 2000a:57) festgeschrieben.
Um im Verkehrssektor langfristig einen ressourcenschonenden Energieverbrauch zu gewährleisten, beschloss die Bundesregierung die Einführung einer ökologischen Steuerreform, die zu einem umweltfreundlicheren Handeln im Verkehrsbereich führen sollte. So wurde mit der Erhöhung der Mineralölsteuer und emissionsorientierter Kfz-Steuer ein Anreiz für eine umweltschonende Fahrweise geschaffen (BMU 2000a:63). Kohlendioxidmissionen sollten zudem mit der Förderung der Entwicklung kraftstoffsparender Fahrzeuge reduziert werden. Demnach wurden deutsche Automobil-konzerne von der Bundesregierung aufgefordert, den Kraftstoffverbrauch der seit 2005 hergestellten Fahrzeuge um 25 Prozent gegenüber 1990 zu senken (BMU 2000a:64). Zudem sollte eine weitere Minderung der Treibhausgasemission durch die Einführung umweltfreundlicher und schwefelarmer Kraftstoffe erreicht werden. Zusätzlich wurde ein Gesamtverkehrskonzept erstellt, das eine integrierte Verkehrsplanung auf Grundlage umweltpolitischer Ziele auf regionaler und städtischer Planungsebene verwirklicht (BMU 2000:66a).
Aussagen über die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemission im Energie-wirtschaftssektor konnten zum damaligen Zeitpunkt im nationalen Klimaschutz-programm nicht genau abgeschätzt werden. Inwiefern es in diesem Sektor zu einer Minderung der CO2-Emissionen kommen sollte, hing von der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung und dem Ausbau der erneuerbaren Energien ab, wobei insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Markteinführungsprogramm für erneuerbare Energien einen Einfluss auf deren Ausbau haben (BMU 2000a:77). Neben den erwähnten Energieträgern sollte sich zudem der Verbrauchsanteil von Erdgas am zukünftigen Energiemix aufgrund seines niedrigen Kohlenstoffdioxidgehalts erhöhen.
3.4 Integriertes Energie- und Klimaprogramm
Am 23. August 2007 beschloss die Bundesregierung die Eckpunkte für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm. Mit diesem Programm wurden die im nationalen Klimaschutzprogramm formulierten Maßnahmen einer umweltschonenden und nachhaltigen Energieversorgung an die zeitliche Entwicklung angepasst und fortgeschrieben. Der Bericht zur Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaprogramms verdeutlicht zum einen den zeitlichen Zwischenstand der im Jahr 2000 geforderten Ziele und beschreibt zum anderen alle notwendigen Maßnahmen, die zum Erreichen der Klimaschutzziele bis 2020 erforderlich sind. Das Maßnahmenpacket des Klimaprogramms wurde auch hier unter dem Gesichtspunkt der geordneten Beendigung der Kernenergie angepasst.
Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm sieht vor, die Kraft-Wärme-Kopplung bis 2020 von zum damaligen Zeitpunkt 12 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Der Bau neuer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmenetze wird dabei durch die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes gefördert. Um Energie einzusparen und effizienter nutzen zu können, wurde die in den Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen produzierte Wärme in Wärmenetze eingespeist und verteilt (BMWi & BMU 2007:9).
Im Ausbau der erneuerbaren Energien sah die Bundesregierung „ein großes Potential für [den] Klimaschutz und für die Einsparung fossiler Brennstoffe“ (BMWi & BMU 2007:4). Der Anteil dieser Energieträger sollte demnach im Jahr 2020 auf 25 bis 30 Prozent steigen und danach weiterhin kontinuierlich erhöht werden. Die Maßnahmen im Ausbau erneuerbarer Energien sollten weiterhin durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden. Ein weiterer Eckpunkt für die Integration erneuerbarer Energien im Strombereich ist der Ausbau der Netzinfrastruktur; eine Maßnahme, die vor allem aufgrund dezentral gelegener On- und Offshore-Windenergieanlagen und des grenz-überschreitenden Stromhandels notwendig ist (BMWi & BMU 2007:12).
Für eine energieeffiziente und klimafreundliche Energieversorgung wurde ebenfalls in die Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien investiert. Da der Anteil der emissionsarmen Kernenergie am Energiemix weiter schwindet, muss diese durch alternative Energieträger mit einer geringen Treibhausgasemission ersetzt werden. So kann beispielsweise in Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken durch die Entwicklung von CCS-Technologien – eine Speichertechnologie für Kohlendioxid – eine Ver-ringerung der Kohlendioxidemission erreicht werden. Aus diesem Grund entwickelte die Bundesregierung eine Richtlinie für CCS-Technologien, in der rechtliche Rahmen-bedingungen, Forschungs- und Entwicklungsstrategien, Konzepte für die Öffentlich-keitsarbeit sowie weitere Handlungsempfehlungen festgehalten werden.
Weitere Punkte des Integrierten Energie- und Klimaprogramms betreffen beispielsweise die Einführung von Energiemanagementsystemen und Förderprogrammen für Klima-schutz und Energieeffizienz sowie die Entwicklung eines CO2-Gebäudesanierungs-programms. Mithilfe von Energiemanagementsystemen wurde in Industrien untersucht, inwiefern Potentiale für die Energieeinsparung und Kostensenkung vorhanden sind, um daraus Empfehlungen und Maßnahmen für eine Erhöhung der Energieeffizienz abzuleiten (BMWi & BMU 2007:24).
[...]
Details
- Titel
- Energiepolitik in Deutschland nach Fukushima: Der Einfluss des Atomunglücks auf die deutsche Energiepolitik
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V296793
- ISBN (Buch)
- 9783863413866
- ISBN (PDF)
- 9783863418861
- Dateigröße
- 409 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Atomausstieg Diskursanalyse Klimaschutzziele Energiedebatte Energiepolitische Kehrtwende Kernenergie Atomenergie
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing
- Arbeit zitieren
- , 2011, Energiepolitik in Deutschland nach Fukushima: Der Einfluss des Atomunglücks auf die deutsche Energiepolitik, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.bachelor-master-publishing.de/document/296793
Service
Per E-Mail: bmp@diplomica.de
Telefonisch Dienstag und Donnerstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie Mittwoch 14:00 bis 15:00 Uhr: +49(0)176-85996762
- Copyright
- © BACHELOR +
MASTER Publishing
Imprint der
Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
BACHELOR + MASTER Publishing veröffentlicht kostenlos
deine Abschlussarbeit als eBook und Buch.
-
Seit 2010 ermöglichen wir die professionelle
Publikation von akademischen Abschlussarbeiten
und Studien aus allen Fachbereichen.